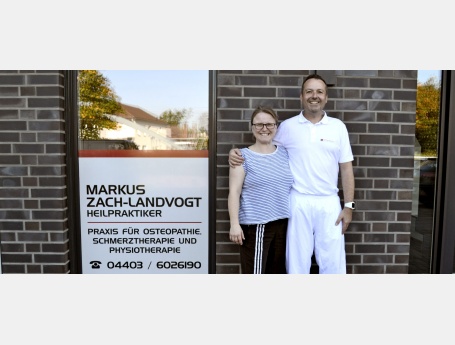Schmerzhaftes Fett an Armen und Beinen
Liposuktion bei Lipödem
Das Lipödem als Erkrankungsbild wurde erstmals 1940 von den US-amerikanischen Ärzten Allen und Hines beschrieben. Ein Lipödem zeichnet sich durch verschiedene Symptome aus. Das Lipödem trifft fast ausschließlich Frauen. Es liegt wohl eine genetische Veranlagung vor. Hormonelle Ursachen sind wahrscheinlich, denn die Beschwerden beginnen meist in Phasen hormoneller Veränderung wie der Pubertät oder nach einer Schwangerschaft. Die Fettgewebezellen vergrößern und vermehren sich. Die kleinsten Blutgefäße, die Kapillaren, werden durchlässiger und verletzlicher und im Bindegewebe kommt es zu Veränderungen. Wassereinlagerungen – Ödeme – verstärken das Problem. Sie nehmen bei Wärme langem Sitzen und Stehen zu. Häufig wird das Lipödem mit einer Fettleibigkeit (Adipositas) verwechselt. Doch beim krankhaften Übergewicht bleiben die Proportionen normal und das Fettgewebe verursacht keine Schmerzen. Das Unterhautfettgewebe im Bereich der Beine und oder Arme nimmt langsam, aber stetig zu. Füße und Hände bleiben dagegen normal ebenso wie der Bauch und Rumpfbereich des Körpers. Je nachdem wie weit das Lipödem fortgeschritten ist, stimmen die Proportionen zwischen Ober- und Unterkörper nicht mehr. Das fällt umso mehr auf, wenn die Betroffenen im Grunde normalgewichtig sind. Die Fettverteilung an den Beinen (bzw. Armen) kann individuell verschieden sein. Sammelt sich das Fett vor allem am oberen Teil des Oberschenkels an liegt eine sogenannte „Reiterhose“ vor. Ist das Fett gleichmäßig über das gesamte Bein verteilt spricht man auch von einem „Säulenbein“. In späteren Stadien bilden sich bei den Betroffenen möglicherweise Fettwülste oberhalb der Knie oder der Sprunggelenke aus. Im Anfangsstadium kann es tatsächlich schwierig sein, ein Lipödem von einer einfachen Adipositas (Fettleibigkeit) abzugrenzen. Schreitet das Lipödem fort, ist es gut an der symmetrisch ausgebildeten Fettverteilungsstörung zu erkennen. Anfangs sind die vom Lipödem betroffenen Gewebebereiche oft „nur“ druckempfindlich, möglicherweise liegt ein Spannungsgefühl vor. In fortgeschrittenen Stadien verstärken sich die Symptome: Die Bereiche reagieren dann sehr schmerzhaft auf Druck können unter Umständen aber auch ohne Druck schmerzen. Insgesamt fühlt sich die Haut der vom Lipödem betroffenen Bereiche weich an und wirkt eher zart und fein. Häufig erkennt man unter der Haut feinste verzweigte Blutgefäße. Zudem entstehen sehr leicht blaue Flecken (Blutergüsse). Im Unterschied zu einem normalen Ödem lässt sich das Gewebe bei einem Lipödem kaum oder gar nicht eindrücken beziehungsweise der Druck hinterlässt keine Delle. Die Beine fühlen sich durch das Lipödem oft schwer an. Bislang gibt es für das Lipödem keine ursächliche Therapie. Dennoch lassen sie die Beschwerden der Erkrankung durch eine Behandlung größtenteils lindern und auch der Umfang der Beine (oder Arme) verringern. Ob bei einem Lipödem eine Therapie notwendig ist, hängt davon ab, wie weit die Erkrankung bereits fortgeschritten ist. Bei einem Lipödem ist das erste Ziel der Therapie, das im Gewebe gespeicherte Wasser so weit wie möglich zu verringern beziehungsweise das Gewebe zu entstauen. Die komplexe physikalische Entstauungstherapie (KPE) ist eine Kombination aus vier verschiedenen Maßnahmen: Manuelle Lymphdrainage (ca. ein- bis zweimal pro Woche), Kompressionsverbände, also spezielle Bandagen, oder Kompressionsstrümpfe (täglich), Krankengymnastik, intensive Hautpflege. Laut Empfehlungen sollte die komplexe physikalische Entstauungstherapie möglichst lebenslang durchgeführt werden, da sich die Ödeme sonst erneut bilden. Auf das Fettgewebe an sich hat die KPE jedoch keine Auswirkungen. Nach einer erfolgreichen Entwässerung des Lipödems kann deshalb eine Liposuktion beim Lipödem entlang der Lymphgefäße infrage kommen. Obwohl eine Kombination aus komplexer physikalischer Entstauungstherapie und Liposuktion (Fettabsaugung) beim Lipödem als Therapie von Experten empfohlen wird, zählt die Fettabsaugung noch nicht zu den Standardtherapien beim Lipödem. Aus diesem Grund müssen Betroffene im Stadium 1 und 2 die Kosten für eine Fettabsaugung in der Regel selbst tragen, da der Eingriff von den Krankenkassen bislang als reine Schönheitsoperation gewertet wird. Nur ab Stadium 3 besteht derzeit die Möglichkeit, dass die Kosten für die Liposuktion von den Krankenkassen übernommen werden können.