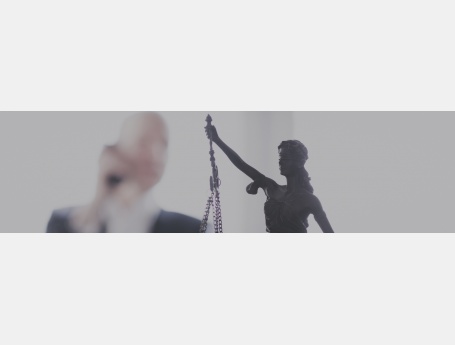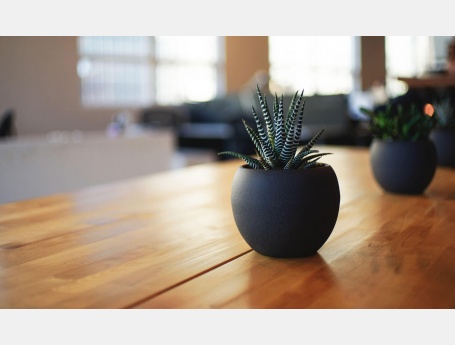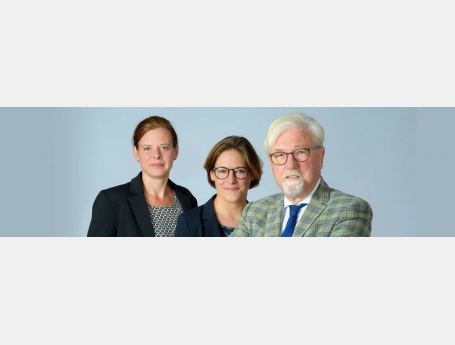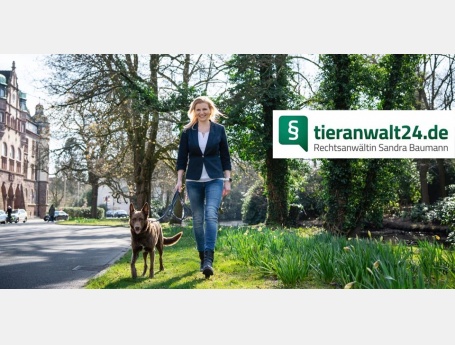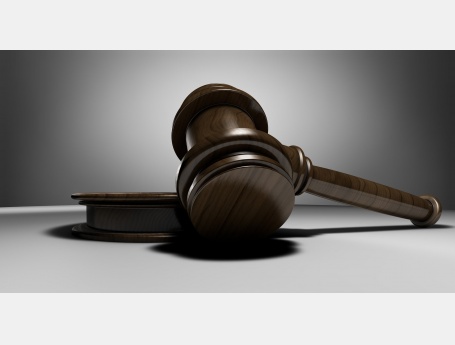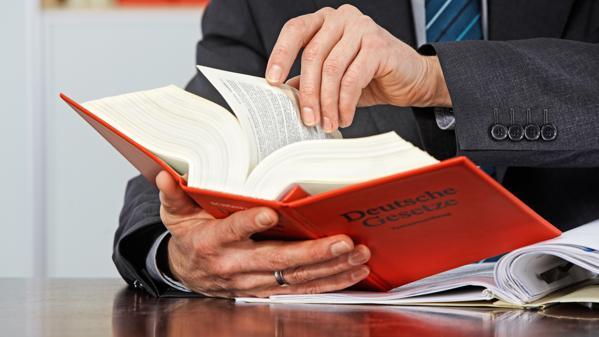
Wie eine Testierunfähigkeit festgestellt wird
Nicht jede geistige Schwäche führt zur Unwirksamkeit eines Testamentes
Die Testierunfähigkeit ist ein Spezialfall der Geschäftsunfähigkeit. Anders als bei der Geschäftsfähigkeit wird aber eine teilweise Testierfähigkeit für „einfache Testamente“ nicht anerkannt. Ein Erblasser ist entweder testierfähig oder testierunfähig. Von einer Testierunfähigkeit ist auszugehen, wenn jemand „wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit, wegen Geistesschwäche oder wegen Bewusstseinsstörung nicht in der Lage ist, die Bedeutung einer von ihm abgegebenen Willenserklärung einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln“ (§ 2229 Abs. 4 BGB). Diese Gesetzesvorschrift bereitet deswegen besondere Probleme, weil sie von Juristen stammt und dort Begriffe verwendet werden, die mit den teilweise gleich lautenden medizinischen Fachbegriffe nicht übereinstimmen. Die Feststellung einer Testierunfähigkeit erfolgt in einem zweistufigen Beurteilungsverfahren: In einem ersten Schritt (Diagnostik) ist zu prüfen, ob eine geistige bzw. psychische Störung vorlag. Sodann ist in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob aufgrund einer solchermaßen festgestellten Störung die freie Willensbestimmung ausgeschlossen war (psychopathologische Symptomatik). Die Beurteilung einer potenziell kritischen psychischen Erkrankung ist allein nach medizinischen Maßstäben vorzunehmen. Testierunfähigkeit kommt in Betracht bei organisch bedingten psychischen Störungen, Demenzen, organischen Psychosen, Schizophrenien, affektive Störungen sowie Intelligenzminderungen (geistige Behinderungen). Keine Testierunfähigkeit besteht regelmäßig bei neurotischen Störungen, Belastungs-Störungen, Verhaltensauffälligkeiten sowie Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen. Die Feststellung einer entsprechenden Erkrankung reicht allerdings nicht aus. Entscheidende Bedeutung hat die zusätzlich fehlende Einsichtsfähigkeit bzw. die fehlende Fähigkeit der eigenständigen Willensbildung. Trotz einer entsprechenden Erkrankung besteht keine Testierunfähigkeit, solange der Betreffende die Fähigkeit hatte, die Bedeutung des Rechtsgeschäfts zu erkennen und sich bei seiner Entscheidung von normalen Erwägungen leiten zu lassen. Testierunfähig ist nur derjenige, dessen Erwägungen und Willensentschlüsse durch krankhaftes Empfinden oder krankhafte Vorstellungen und Gedanken derart beeinflusst werden, dass sie tatsächlich nicht mehr frei sind, vielmehr von diesen krankhaften Einwirkungen beherrscht werden. Ausreichend ist, dass diese Umstände die Errichtung einer letztwilligen Verfügung entscheidend beeinflussen. Als testierunfähig ist daher auch derjenige anzusehen, der nicht in der Lage ist, sich über die für und gegen seine letztwillige Verfügung sprechenden Gründe ein klares, von krankhaften Einflüssen nicht gestörtes Urteil zu bilden und nach diesem Urteil frei von Einflüssen etwaiger interessierter Dritter zu handeln (ständige Rechtsprechung, bspw. BGH, FamRZ 1958, Seite 127 ff.). In der Praxis haben folgende Umstände besondere Bedeutung: • Mittlere bis schwere Gedächtnisstörungen können einer Testierfähigkeit entgegenstehen. • Bei einem Intelligenzquotienten (IQ) unterhalb von 60 ist mit Testierunfähigkeit zu rechnen. • Wahnvorstellungen und andere krankhafte Realitätsverkennungen sind relevant, wenn sie sich inhaltlich auf einen für die Testamentserrichtung wesentlichen Sachverhalt erstrecken. • Grundlose Aggressivität kann auf Testierunfähigkeit hindeuten. • Persönlichkeitsveränderungen, insbesondere aufgrund von Alkoholismus oder Rauschgift-Missbrauch, stehen oftmals einer Testierfähigkeit entgegen. • Testierunfähig ist auch derjenige, dem aufgrund einer Fremdbeeinflussbarkeit eine kritische Distanz und eine eigenständige Abwägung von Argumenten nicht mehr möglich ist. Bei der Beurteilung der Geschäftsfähigkeit bzw. auch der Testierfähigkeit sind nicht so sehr die Fähigkeiten des Verstandes ausschlaggebend als vielmehr die Freiheit des Willensentschlusses. Es kommt darauf an, dass dem Betreffenden eine freie Entscheidung aufgrund einer Abwägung des Für und Wider und eine sachliche Prüfung der in Betracht kommenden Gesichtspunkte möglich ist. Entscheidend ist aber immer das individuelle Gesamtbild der betreffenden Person und aller äußerer Umstände im Zeitpunkt der Errichtung des Testamentes. Autor des Beitrags: Dr. Ulf Künnemann, Rechtsanwalt und Steuerberater, Fachanwalt für Erbrecht, Steuerrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht