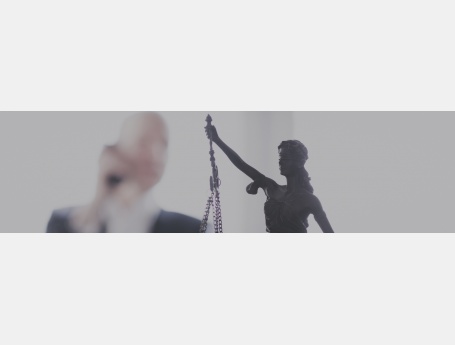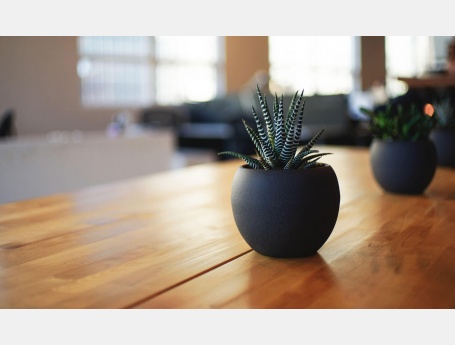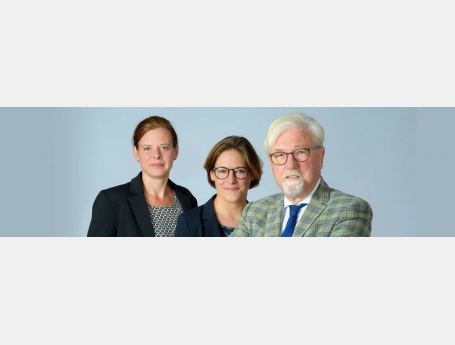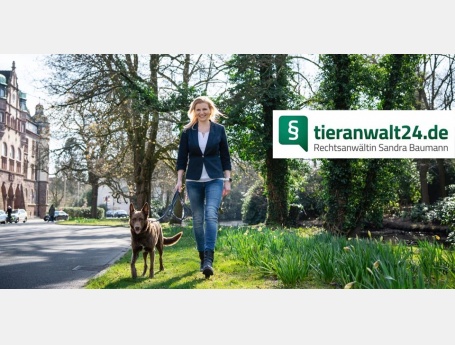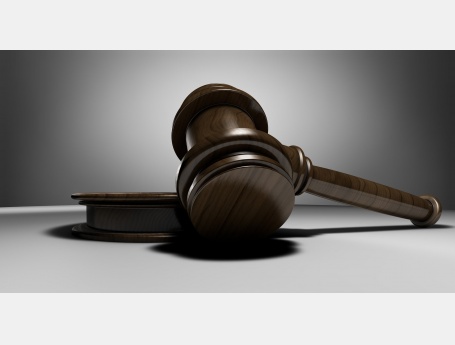Umgangsrecht für Großeltern
Erziehungsvorrang der Eltern ist im Grundgesetz verankert
Fast 20 Jahre nach der Einführung des Umgangsrechts für die Großeltern hat sich jetzt der Bundesgerichtshof in einer aktuellen Entscheidung (BGH 02.07.2017 – Az. XII ZB 350/16) erstmalig damit auseinandergesetzt. Im entschiedenen Fall wollten Großeltern aus dem Raum Erding bei München den Umgang mit ihren heute acht und zehn Jahre alten Enkeln gerichtlich erzwingen. Nach der Geburt der Kinder hatten die Großeltern noch regelmäßig Kontakt. Doch bereits zum damaligen Zeitpunkt mischten sich die Großeltern ständig in die Erziehung der Kinder ein. 2009 kam es deshalb zum Kontaktabbruch. 2011 erlaubten die Eltern wieder den Umgang mit den Enkeln, nachdem die Großeltern ein zinsloses Darlehen zur Verfügung gestellt hatten. Das Darlehen sollte sofort zurückgezahlt werden, wenn das Umgangsrecht nicht mehr gewährt werde. Die Großeltern wollten die Erziehung der Eltern allerdings weiterhin nicht akzeptieren. Beim Jugendamt gaben sie an, dass es „Vorfälle von seelischer Misshandlung der Enkelkinder“ gebe. Daraufhin verboten die Eltern jeglichen weiteren Umgang mit den Kindern. Auch die Kinder selbst wollten nur noch dann zu Opa und Oma, wenn der Streit beendet wird. Der BGH entschied, dass der Umgang der Großeltern mit dem Kind regelmäßig nicht seinem Wohl dient, wenn die – einen solchen Umgang ablehnenden - Eltern mit den Großeltern so zerstritten sind, dass das Kind bei einem Umgang in einen Loyalitätskonflikt geriete. Daneben sei zu berücksichtigen, dass der Erziehungsvorrang nach dem Grundgesetz den Eltern zugewiesen sei. Ein Umgangsrecht der Großeltern sei auch dann nicht im Interesse der Kinder, wenn die Großeltern diesen Erziehungsvorrang missachteten. Nach dem Gesetz haben dritte Personen wie Großeltern zwar ein Umgangsrecht – aber nur, wenn dies dem Kindeswohl dient. Offen ließ der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung die Frage, ob es tragfähige Bindungen der Kinder zu ihren Großeltern gab. Diese Frage könne dahinstehen, denn ein erzwungener Kontakt zu den Großeltern würde hier zu massiven Loyalitätskonflikten und erheblichen Belastungen der Kinder führen. Die Vorwürfe der Großeltern seien außerdem falsch. Allein der Umstand, dass das zuletzt eingeräumte Umgangsrecht nur wegen eines Darlehens gewährt wurde, zeige das desolate Verhältnis zwischen Eltern und Großeltern. Der Bundesgerichtshof hat in diesem Fall vollkommen zu Recht und mit zutreffender Begründung entschieden. Die Vorwürfe der Großeltern hatten sich als haltlos erwiesen. Aufgrund des grundgesetzlich geschützten Erziehungsvorrangs der Eltern haben und werden die Familiengerichte allerdings auch häufig zu Lasten der Großeltern entscheiden, wenn sich die Ursache der Konflikte nicht aufklären lässt oder bei den Eltern liegen. Auch im entschiedenen Fall war es ja zumindest fragwürdig, dass sich die Eltern ihre Kinder durch ein zinsloses Darlehen quasi haben „abkaufen“ lassen. Nicht im entschiedenen Fall, aber sonst stellt sich daher die Frage, ob es nicht ungerecht ist, dass Eltern den Umgang des Kindes mit seinen Großeltern verhindern können, indem sie selbst das Kind in einen Loyalitätskonflikt stürzen. Letztlich wird diese Frage aber von unserer Verfassung beantwortet. Der Erziehungsvorrang der Eltern ist im Grundgesetz verankert. Er gilt gegenüber allen anderen Personen, sogar gegenüber dem Staat. Dieser Regelung liegt unter anderem die Erwägung zugrunde, dass es – auch und gerade aus Sicht des Kindes – eindeutig sein muss, welche Personen in seinem Leben „das letzte Wort“ haben, und dass diese Rolle natürlicher Weise den Eltern zukommt. Autor des Beitrags:
Umgangsrecht mit ihren Enkelkindern zu. In § 1685 Abs. 1 BGB heißt es: „Großeltern und
Geschwister haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient.“ Aber der Erziehungsvorrang der Eltern ist im Grundgesetz auch eindeutig verankert.