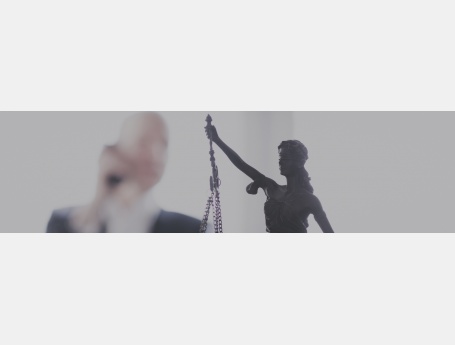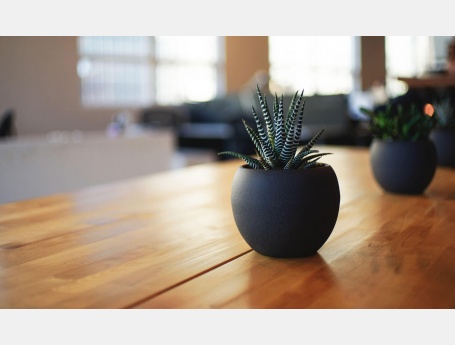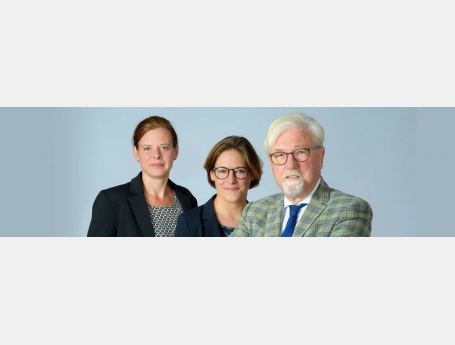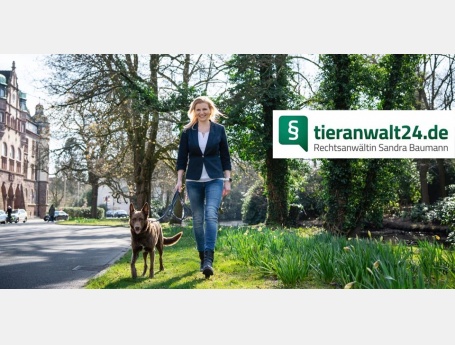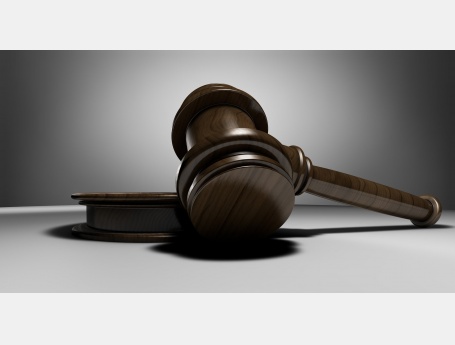Rechtzeitig Insolvenz anmelden
Anfechtung trotz Zahlungsfähigkeit
Der Geschäftsführer einer Gesellschaft muss einen Insolvenzantrag stellen, sobald die GmbH zahlungsunfähig oder überschuldet ist. Beides sind Fachbegriffe aus der Insolvenzordnung. „Zahlungsunfähigkeit“ bedeutet, dass die fälligen Verbindlichkeiten die vorhandenen liquiden Mittel um zehn Prozent übersteigen. „Überschuldet“ ist das Unternehmen, wenn das Vermögen die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt. Der Geschäftsführer ist in kritischen Zeiten sogar dazu verpflichtet, ständig eine mögliche Zahlungsunfähigkeit im Blick zu haben und gegebenenfalls Vermögensbilanzen erstellen zu lassen. Doch auch für den Geschäftspartner drohen Probleme und Risiken, wenn er erfährt, dass die Gesellschaft, mit der man in laufender Geschäftsbeziehung steht, möglicherweise zahlungsunfähig ist. Der Insolvenzverwalter kann nämlich – unter Umständen – Zahlungen zurückverlangen, die die insolvente Gesellschaft geleistet hat. Juristisch spricht man dabei von „Anfechtung“. Wenn der Geschäftspartner von der Überschuldung oder der Zahlungsunfähigkeit Kenntnis hatte, kommt sogar eine Anfechtung wegen vorsätzlicher Benachteiligung in Betracht. Diese ermöglicht eine Anfechtung auch solcher Zahlungen, die schon bis zu zehn Jahre zurückliegen. Das gilt aber nur dann, wenn man als Geschäftspartner im Zeitpunkt der Leistung wusste, dass die Insolvenz droht und dass andere Geschäftspartner benachteiligt werden. Nach ständiger Rechtsprechung wird diese Kenntnis aber vermutet, wenn der Geschäftspartner zur Zeit der Leistung wusste, dass die Zahlungsunfähigkeit der nunmehr insolventen Gesellschaft drohte und dass die Leistung die übrigen Gläubiger benachteilig. Etwas anderes soll jedoch dann gelten, wenn konkrete Umstände nahe legen, dass die Krise noch abgewendet werden kann. Der Bundesgerichtshof hat sich im Januar 2016 mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Voraussetzungen der Vorsatzanfechtung auch dann zu bejahen sind, wenn der Schuldner im Zeitpunkt der angefochtenen Handlung zwar noch uneingeschränkt zahlungsfähig ist, aber bereits feststeht, dass etwaige Fördermittel, von denen eine kostendeckende Geschäftstätigkeit abhängt, alsbald nicht mehr gewährt werden (BGH, Urteil vom 21.1.2016 – IX ZR 84/13). Nach Ansicht des Bundesgerichtshofes können entsprechende Leistungen auch bei tatsächlicher Zahlungsfähigkeit der (späteren) insolventen Gesellschaft zurückgefordert werden, wenn man als Geschäftspartner weiß, dass in absehbarer Zeit bestimmte Gelder nicht mehr gezahlt werden und noch kein Konzept für eine Unternehmenssanierung besteht. Das bedeutet für die Gläubiger einer (vermeintlich bald) zahlungsunfähigen Gesellschaft, dass sie bei Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit ihres Geschäftspartners prüfen sollten, ob sie selbst einen Insolvenzantrag stellen sollten. Denn auch als Gläubiger einer insolventen Gesellschaft ist man berechtigt, einen Insolvenzantrag zu stellen. Eine Pflicht zur Antragstellung besteht für die Gläubiger aber nicht. Wenn es zu Schwierigkeiten mit dem (zahlungsunfähigen) Partner kommt, sollte man sich umgehend mit diesem in Verbindung setzten und die entsprechenden Geschäftsbeziehungen gemeinsam erörtern und nach einer Lösung suchen. Wenn dieser versichert, dass es in Zukunft zu keinen „Engpässen“ mehr kommen wird, kann man als Geschäftspartner vorschlagen, in Zukunft nur noch gegen Vorkasse zu leisten.