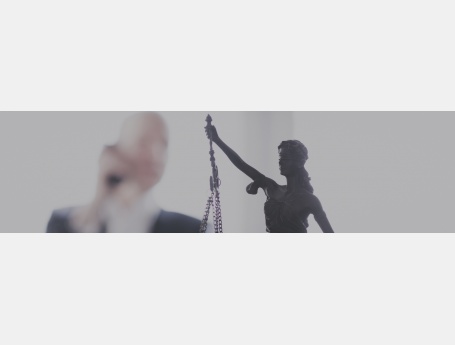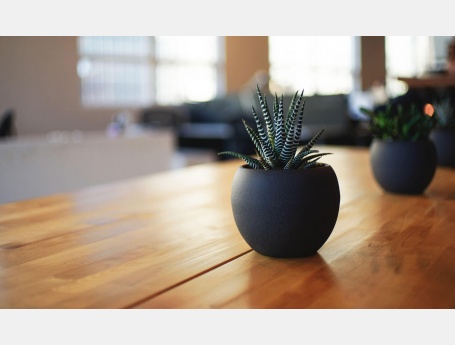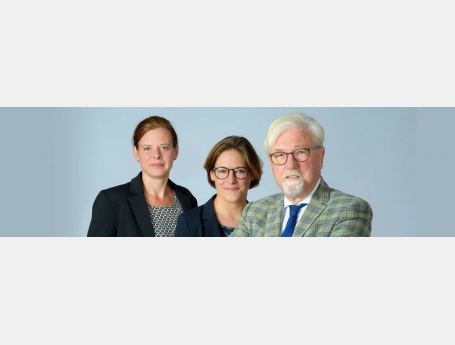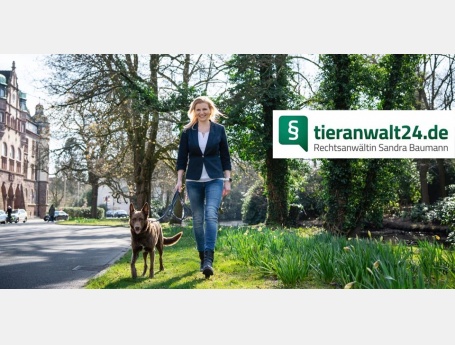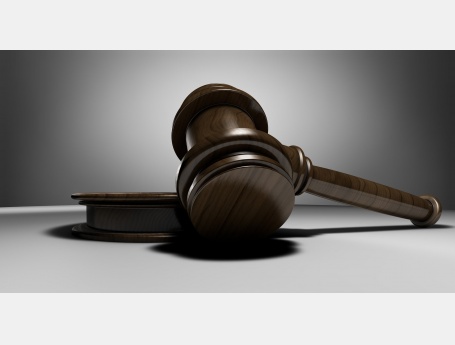Nicht jede Schenkung ist ausgleichspflichtig
Schenkungen dürfen durch einen Erbvertrag nicht zu einer Benachteiligung führen
Schenkungen dürfen aber auch nicht dazu führen, dass Erben aufgrund eines Erbvertrages beeinträchtigt werden (§ 2287 BGB). Nach dieser Vorschrift kann der Erbe/können die Erben nach dem Tod des Erblassers die Herausgabe des Geschenks bzw. gegebenenfalls des entsprechenden Wertes verlangen. Diese Regelung ist auf wechselbezügliche Verfügungen eines gemeinschaftlichen Testamentes, das nach dem Tod des erstversterbenden Ehegatten unwiderruflich geworden ist, entsprechend anzuwenden (ständige Rechtsprechung des BGH). Der BGH musste sich in einem aktuell veröffentlichten Urteil vom 28. September 2016 (zu Aktenzeichen IV ZR 513/15) mit einer Klage des Sohnes der Erblasser gegen seine Schwester befassen, die auf diese Vorschrift gestützt war. Die Eltern hatten sich in einem typischen „Berliner Testament“ wechselseitig zu Alleinerben und nach dem Tod des Längstlebenden die beiden Kinder zu gleichen Teilen zu Schlusserben eingesetzt. Nach dem Tod der Ehefrau übertrug der Ehemann das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück auf die Tochter. Der Ehemann behielt sich an dem gesamten Grundstück ein lebenslanges Nießbrauchsrecht sowie ein unter bestimmten Voraussetzungen ausübbares vertragliches Rücktrittsrecht vor. Außerdem verpflichtete sich die Tochter, den Ehemann „Zeit seines Lebens in gesunden und kranken Tagen, jedoch nur bei Bedarf, in seiner Wohnung vollständig und unentgeltlich zu pflegen und zu betreuen bzw. ihn kostenlos pflegen und betreuen zu lassen“. Der Ehemann verstarb später; er hatte bis kurz vor seinem Tod in dem Haus gewohnt, ohne pflegebedürftig geworden zu sein. Nachdem die Tochter anschließend das Grundstück veräußert hat, beanspruchte der Bruder von ihr die Hälfte des Kaufpreises. Der BGH hat diesen Rechtsstreit zum Anlass genommen, seine grundsätzliche Sichtweise zu § 2287 BGB darzustellen. Zunächst hat der BGH die ständige Rechtsprechung bestätigt, wonach diese Vorschrift auch auf wechselbezügliche Verfügungen in einem gemeinschaftlichen Testament anwendbar ist. Weiterhin hat sich der BGH mit den Voraussetzungen befasst, unter denen eine Schenkung (im Sinne von Selbst wenn nach den vorstehenden Grundsätzen eine – zumindest gemischte – Schenkung vorgelegen habe, führe dies noch nicht automatisch zu einem Anspruch des bzw. der Erben auf Herausgabe des Geschenkes bzw. auf Wertersatz. Hierzu sei zusätzlich erforderlich, dass der Erblasser in der Absicht gehandelt hat, den bzw. die Erben zu beeinträchtigen. Erforderlich dafür sei, dass der Erblasser das ihm verbliebene Recht zur lebzeitigen Verfügung missbraucht hat. Kein Missbrauch liege vor, wenn der Erblasser eine lebzeitiges Eigeninteresse an der von ihm vorgenommenen Schenkung hatte. Ein solches lebzeitiges Eigeninteresse sei anzunehmen, wenn aus Sicht eines objektiven Beobachters die Verfügung in Anbetracht der gegebenen Umstände auch unter Berücksichtigung der erbvertragliche Bindung als billigenswert und gerechtfertigt erscheint. Ein derartiges Interesse komme etwa dann in Betracht, wenn es dem Erblasser im Alter um seine Versorgung und gegebenenfalls auch Pflege geht oder wenn der Erblasser in der Erfüllung einer sittlichen Verpflichtung handelt, er etwa mit dem Geschenk einer Person, die ihm in besonderem Maße geholfen hat, seinen Dank abstatten will. Beweispflichtig für die Schenkung ohne rechtfertigendes lebzeitiges Eigeninteresse sei der vermeintlich beeinträchtigte Vertrags- bzw. Schlusserbe. Selbst wenn also eine Bindung aufgrund eines Erbvertrages oder aufgrund eines gemeinschaftlichen Testamentes besteht, ist man nicht generell gehindert, Vermögen zu Lebzeiten unentgeltlich bzw. teilentgeltlich zu übertragen. Der Beschenkte ist nicht in jedem Fall zur Rückgabe bzw. zum Wertersatz verpflichtet.
§ 516 BGB) vorliegen kann. Denn selbst wenn Gegenleistungen vereinbart sind, kann zumindest eine „gemischte Schenkung“ vorliegen, die ebenfalls unter § 2287 BGB fällt.
Ersatz oder Rückgabe