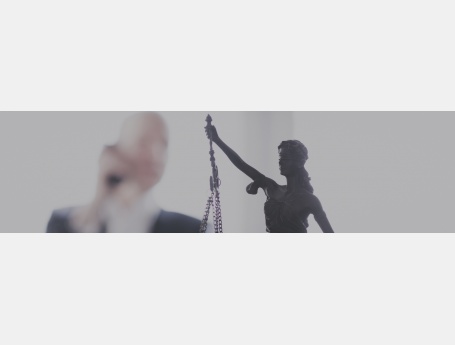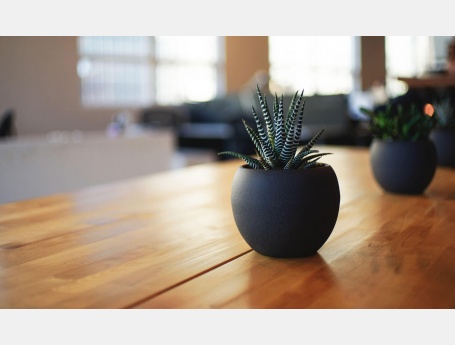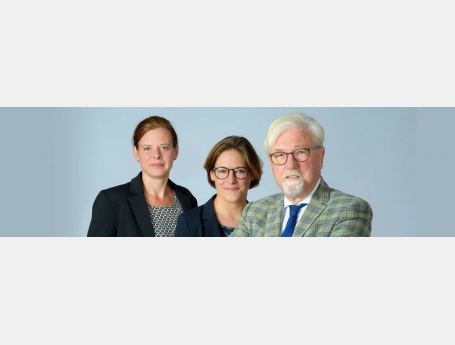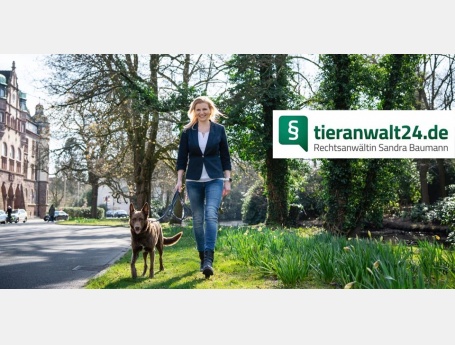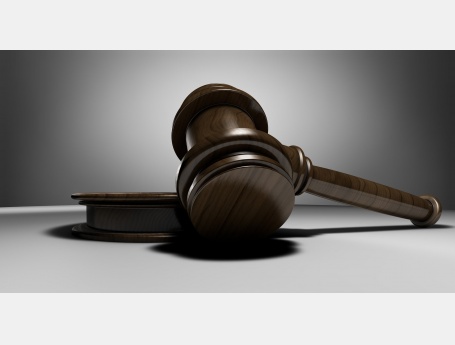Ist die Kopie eines Testaments wirksam?
Nachlassgericht ist zur Amtsermittlung verpflichtet
Die Eheleute S. hatten ein gemeinschaftliches Testament errichtet. Dieses Testament sah vor, dass der erstversterbende Ehegatte vom längerlebenden Ehegatten allein beerbt werden solle. Der Sohn S 1 wurde als Schlusserbe nach dem letztversterbenden Ehegatten eingesetzt. Der weitere Sohn S 2 wurde enterbt und auf den Pflichtteil gesetzt. Nachdem der Ehemann verstorben war, hat die Ehefrau eine Kopie des Testaments beim Nachlassgericht eingereicht und einen Alleinerbschein zu ihren Gunsten beantragt. Die Ehefrau erklärte, die Eheleute hätten den Text geschrieben und jeweils unterzeichnet. Das Original des Testaments habe man einvernehmlich unter „der Tischdecke mit der Nähmaschine darauf im Vorraum zwischen Küche und Bad“ des Hauses aufbewahrt. Nun sei das Original allerdings verschwunden und nicht mehr auffindbar. Das Nachlassgericht hat zugunsten der Ehefrau einen Erteilungsbeschluss als Alleinerbin erlassen, nachdem die Ehefrau eidesstattlich versichert hatte, nicht im Besitz des Originals des Testaments zu sein, das Testament gemeinsam mit dem Erblasser errichtet zu haben und angeben zu können, dass die Unterschrift vom verstorbenen Ehemann stamme. Gegen den Beschluss hat der enterbte Sohn S 2 Beschwerde eingelegt. Der Sohn S 2 rügte insbesondere, dass das Nachlassgericht den Sachverhalt lediglich im Freibeweis ermittelt habe und die Unterschrift des Erblassers unter Berücksichtigung einer Vergleichsunterschrift nicht echt sein könne. Das Nachlassgericht hat der Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache dem Oberlandesgericht Karlsruhe zur Entscheidung vorgelegt. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat sodann die Ehefrau sowie den Sohn S 2 persönlich angehört. Darüber hinaus wurde ein Schriftsachverständigengutachten eingeholt. Das Oberlandesgericht Karlsruhe gelangte zu dem Ergebnis, dass das Nachlassgericht rechtsfehlerhaft agiert habe. Im vorliegenden Fall sei eine förmliche Beweisaufnahme und damit der Strengbeweis zwingend notwendig gewesen. An den Nachweis der Gültigkeit und des Inhalts eines im Original nicht mehr vorhandenen Testaments seien strenge Anforderungen zu stellen. Wenn das Original eines Testaments nicht mehr vorhanden sei, sondern der Nachweis der Erbfolge auf eine Kopie des Testaments gestützt werde, bedürfe es besonders sorgfältiger Ermittlungen. Das Nachlassgericht habe sich daher nicht mit einer eidesstattlichen Versicherung begnügen dürfen, sondern stattdessen die Beteiligten anhören und ein Schriftsachverständigengutachten einholen müssen. Im Ergebnis hielt das Oberlandesgericht Karlsruhe die Beschwerde allerdings für unbegründet. Nach der durchgeführten Beweisaufnahme entschied das Oberlandesgericht Karlsruhe, dass sich die Erbfolge nach der vorgelegten Testamentskopie richte. Allein aus der Vorlage einer Fotokopie eines Testaments könne ein Erbrecht zwar nicht abgeleitet werden. Der Nachweis der Erbfolge könne aber auch auf andere Weise geführt werden. Nach der Anhörung der Ehefrau sowie des Sohnes S 2 und der Beweisaufnahme durch Einholung eines Schriftsachverständigengutachtens war das Oberlandesgericht Karlsruhe davon überzeugt, dass der Erblasser und die Ehefrau ein gemeinschaftliches Testament mit dem aus der Kopie des Testaments ersichtlichen Inhalt errichtet hätten. Der vorliegende Fall führt noch einmal nachdrücklich vor Augen, wie wichtig es ist, nicht nur frühzeitig die Erbfolge durch die Errichtung eines Testaments zu regeln, sondern das Original des Testaments auch in die Verwahrung des Nachlassgerichts zu geben. Das Nachlassgericht sorgt dann auch dafür, dass das Testament im Zentralen Testamentsregister registriert wird. Diese Verwahrung sowie die Registrierung haben den Vorteil, dass das Original dann beim Erbfall auch tatsächlich aufgefunden werden kann, so dass unnötige Streitigkeiten vermieden werden können.