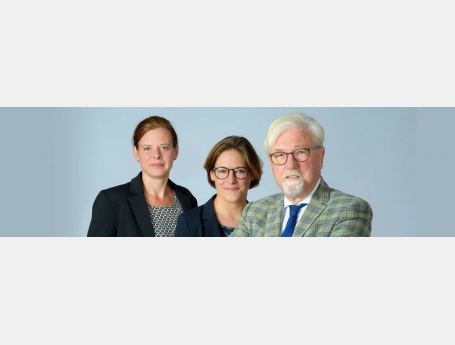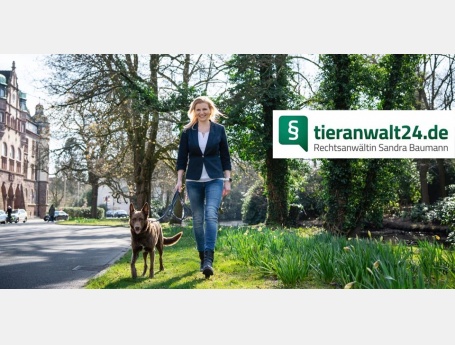Aspekte der Testier(un)fähigkeit
In letzter Zeit haben sich die Obergerichte in veröffentlichten Entscheidungen mehrfach mit dem Thema einer möglichen Testierunfähigkeit befasst. Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf musste in einer Entscheidung vom 10. Oktober 2013 (Aktenzeichen I-3 Wx 116/13) beurteilen, unter welchen Voraussetzungen für das Nachlassgericht von Amts wegen die Pflicht besteht, durch Einholung eines Gutachtens die Testier(un)fähigkeit feststellen zu lassen. Nach Auffassung des OLG Düsseldorf reichen hierfür allgemein formulierte Zweifel eines Beteiligten (potenziellen gesetzlichen Erben) an der Testierfähigkeit nicht aus. Es müssen vielmehr fallbezogene objektivierte oder nachprüfbare Tatsachen oder Indizien (zum Beispiel auffälliges symptomatisches Verhalten) behauptet werden, die sowohl für das Vorhandensein eines einschlägigen Krankheitsbildes bei dem Erblasser im Zeitpunkt der Testamentserrichtung als auch für einen konkreten Einfluss auf die Testierfähigkeit des Erblassers zum maßgeblichen Zeitpunkt sprechen. Nur wenn in diesem Sinne konkrete Zweifel an der Testierfähigkeit im Zeitpunkt der Errichtung des Testamentes bestehen, ist die Einholung des Gutachtens eines psychiatrischen oder nervenfachärztlichen Sachverständigen geboten. Das Gericht müsste zunächst die konkreten auffälligen Verhaltensweisen des Erblassers aufklären, sich sodann Klarheit über den medizinischen Befund verschaffen und anschließend die hieraus zu ziehenden Schlüsse prüfen. Wenn danach weitere Zweifel an der Testierfähigkeit bestehen, sind diese regelmäßig durch das Gutachten eines psychiatrischen oder nervenärztlichen Sachverständigen zu klären, wobei der Sachverständige anhand von Anknüpfungstatsachen nicht nur den medizinischen Befund feststellen muss, sondern vor allem auch dessen Auswirkungen auf die Einsichts- und Willensbildungsfähigkeit des Erblassers zu klären hat. Notare äußern sich im Rahmen in der Errichtung von Testamenten regelmäßig zur Geschäfts- bzw. Testierfähigkeit. Hintergrund ist eine Regelung im Beurkundungsgesetz, wonach der Notar eine Beurkundung eines Testamentes nicht vornehmen darf, wenn nach seiner Überzeugung einem Beteiligten die Testierfähigkeit fehlt. Einer Entscheidung des OLG Düsseldorf vom 16. Januar 2013 (Aktenzeichen I-3 Wx 27/12) lag der Sachverhalt zugrunde, dass der Notar im Rahmen der notariellen Urkunde Zweifel geäußert hat, diese nach seiner Auffassung ihn allerdings – zutreffend – nicht davon abgehalten haben, die Beurkundung vorzunehmen. Das OLG Düsseldorf kam zu dem Ergebnis, dass vom Nachlassgericht im Rahmen der Amtsermittlungspflicht Erkundungen vorzunehmen waren, um sich selbst über die Testierfähigkeit zu überzeugen. Weitergehend ist festzustellen, dass allein aus dem üblichen Hinweis des Notars, er habe sich von der Testierfähigkeit überzeugt, kein zwingender Rückschluss auf eine tatsächlich bestehende Testierfähigkeit gezogen werden kann. Demenzkranke Personen unterliegen häufig gewissen Schwankungen im Hinblick auf ihren Gesundheitszustand. In der Vergangenheit wurde bei demenzkranken Personen gelegentlich von „lichten Momenten“ ausgegangen, in denen eine vorübergehende Testierfähigkeit angenommen wurde. Auf Basis eines entsprechenden Sachverständigengutachtens hat das OLG München am 1. Juli 2013 (Aktenzeichen 31 Wx 266/12) entschieden, dass bei einer chronisch fortschreitenden Demenz „lichte Momente“, in denen eine Testierfähigkeit vorliegt, praktisch ausgeschlossen sind. Dies deckt sich mit neueren medizinischen Erkenntnissen, wonach vorübergehende Verbesserungen der Aufmerksamkeit oder Wahrnehmungsfähigkeit nicht mit einer Verbesserung geistiger Fähigkeiten insbesondere der Urteils- oder Willensbildung, gleichzusetzen sind. In den typischen Fällen degenerativer Demenz (insbesondere Alzheimer-, Lewy-Körperchen- und Parkinson-Demenz) kann es demnach nicht zu vorübergehender Testierfähigkeit kommen. Autor: Dr. Ulf Künnemann, Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Erbrecht, für Steuerrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht mit den Tätigkeitsschwerpunkten Erbrecht, Gesellschaftsrecht und Unternehmensnachfolge, Partner der Sozietät Korte Dierkes Künnemann und Partner (KDK), Oldenburg, Telefon: 0441/ 97 37 80 ( www.kdk-rae.de ).