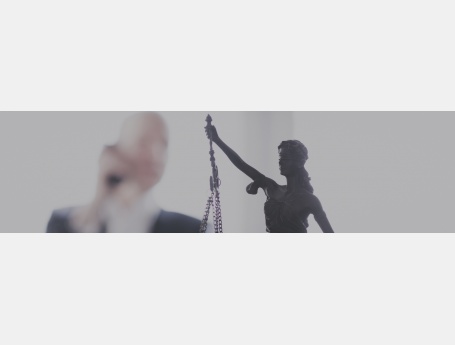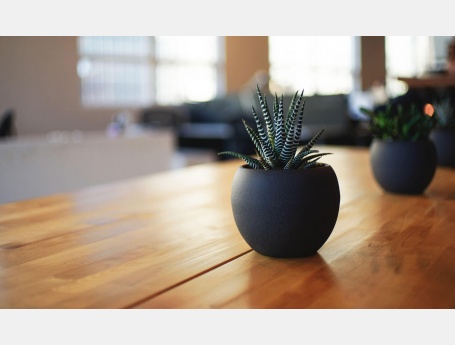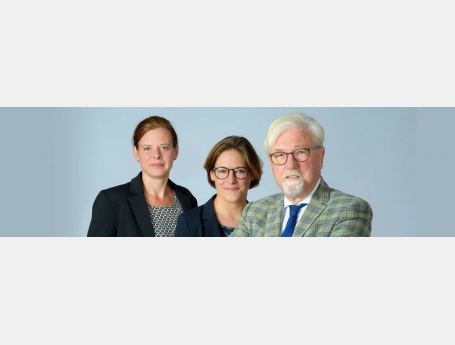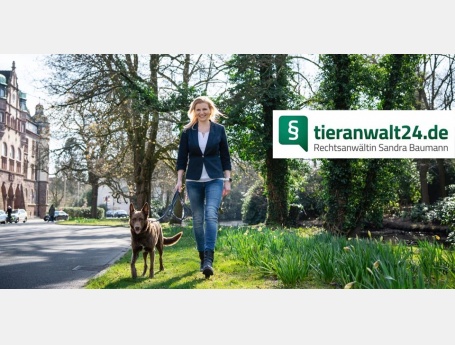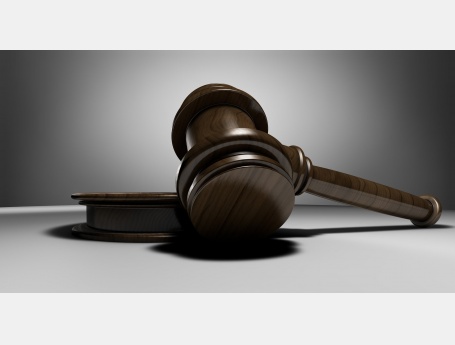Anrechnung und Ausgleichung im Erbrecht
Bedeutung bei Erbengemeinschaften und bei der Berechnung von Pflichtteilsansprüchen
Erbrechtliche Auseinandersetzungen beziehen sich nicht immer nur auf den Nachlass im Zeitpunkt des Todes. Lebzeitige Verfügungen des Erblassers (Schenkungen) oder andere Umstände (zum Beispiel unentgeltliche Pflege) können auch Auswirkungen auf die Höhe erbrechtlicher Ansprüche haben. Derartige Umstände werden gegebenenfalls im Wege einer Anrechnung oder einer Ausgleichung berücksichtigt. Während bei einer Anrechnung ein Abzug vorgenommen wird, führt die Ausgleichung zu einer Verschiebung von Ansprüchen in der Weise, dass der auszugleichende Wert dem gesamten Nachlass hinzugerechnet und nach quotenmäßiger Verteilung vom Anteil des Begünstigten wieder abgezogen wird. Beispiel: A und B bilden eine Erbengemeinschaft zu je ½. Der Nachlass beträgt 200 000 Euro. B hat zu Lebzeiten bereits ausgleichungspflichtig 100 000 Euro erhalten. Aufgrund der Ausgleichung wird der Nachlass rechnerisch um 100 000 Euro auf 300 000 Euro erhöht. Der Anteil des B beträgt 150 000 Euro, wovon allerdings die 100 000 Euro abzuziehen sind. Im Rahmen der Verteilung erhält A 150 000 Euro, B hingegen nur 50 000 Euro. Im Ergebnis erfolgt hierdurch ein angemessener Ausgleich zwischen A und B. Anrechnung und Ausgleichung haben eine Bedeutung bei Erbengemeinschaften und bei der Berechnung von Pflichtteilsansprüchen. Bei gewillkürter Erbfolge (durch Testament oder Erbvertrag) finden sie im Hinblick auf die Verteilung des Nachlasses nur Anwendung, wenn sie vom Erblasser ausdrücklich angeordnet sind. Bei gesetzlicher Erbfolge ist die Ausgleichung in einigen Fällen gesetzlich vorgeschrieben, nämlich: Eine spätere Anordnung bei Schenkungen ist nicht möglich; in derartigen Fällen stehen den nicht beschenkten Geschwistern gegebenenfalls Pflichtteilsergänzungsansprüche zu. Weitere Fälle der Ausgleichung sind die lebzeitige Pflege, Mitarbeit im Haushalt bzw. Unternehmen, Geldzuwendungen oder andere Beiträge durch erbberechtigte Personen, die dazu geführt haben, dass das Vermögen des Erblassers vermehrt oder abgesichert wurde. In derartigen Fällen orientiert sich die Höhe des Ausgleichsanspruchs an der Höhe des Nachlasses sowie an Dauer und Umfang der erbrachten Leistungen. Auf Pflichtteilsansprüche sind Schenkungen ebenfalls anzurechnen, wenn der Erblasser dies bei der Schenkung bestimmt hat. Auch insoweit ist eine spätere Anrechnungsbestimmung, beispielsweise im Rahmen des Testamentes, nicht mehr möglich. Um spätere Streitigkeiten zu vermeiden, sollte bei einer Schenkung in jedem Fall schriftlich bestimmt werden, ob eine Anrechnung auf Pflichtteilsansprüche oder Ausgleichung im Rahmen einer Erbengemeinschaft zu erfolgen hat. Weitergehend wirken sich ausgleichungspflichtige Umstände auch im Pflichtteilsrecht aus. Bei der Berechnung des Pflichtteilsanspruchs wird ein fiktiver Nachlass der pflichtteilsberechtigten Person ermittelt, nach dem sich die Höhe des Pflichtteils errechnet. Bei dieser Berechnung des fiktiven Nachlasses erfolgt ebenfalls eine Hinzurechnung ausgleichungspflichtiger Umstände, quotenmäßige Verteilung und Abzug der betreffenden Beträge bei der jeweiligen begünstigten Person. Insbesondere in den Fällen unliebsamer pflichtteilsberechtigter Erben sollte bei der Vornahme von Zuwendungen tunlichst darauf geachtet werden, dass die richtigen Anrechnungs- oder Ausgleichungsbestimmungen getroffen und nachweisbar dokumentiert werden.