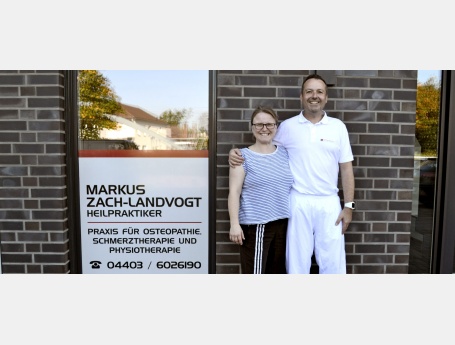Allgemeine Gesundheit
>Können Stärken auch Schwächen, Schwächen auch Stärken sein?

Können Stärken auch Schwächen, Schwächen auch Stärken sein?
Die individuelle Sicht auf persönliche Fähigkeiten verändern
Resultiert daraus ein Vermeidungsverhalten z.B. in Form von kann daraus ein Leidensdruck entstehen. Die Stärken des guten Zuhörens oder der Hilfsbereitschaft werden genannt, doch oft werden diese ins Außen projiziert. Wo aber darf ich es mir erlauben, mir selbst zuzuhören, mir selbst etwas Gutes zu tun? Manchmal steht der eigene Glaubenssatz „ich muss mich kümmern, immer für andere (Familienmitglieder) da sein“, im Konflikt zu der oben genannten Stärke. Doch wie wäre es, würden diese hemmenden Gedanken durch zielführende, hilfreiche ersetzt? Gäbe es dann die Motivation, eigene Ziele positiv energievoller anzutreten? In vergangenen „Passivsituationen“ entwickelte Verhaltens- und Denkstrategien müssen nicht zwingend im Hier und Jetzt hilfreich sein. Oftmals basiert die individuelle Verletzbarkeit auf Erfahrungen. Diese sind jedoch, da sie in der Vergangenheit liegen, unveränderbar. Veränderbar ist jedoch der Umgang mit diesen in der Gegenwart. Sich dieses bewusst zu machen, kann ein erster Schritt in die Veränderung sein. Befindet sich der Betroffene in altbekannten, belastenden Situationen, kann mit Blick auf die persönlichen Stärken und Fähigkeiten ein angemessener, zielführender Umgang mit diesen gefunden werden. Aus der gedanklichen Passivität entsteht ein bewusstes aktives Denken und Handeln. Abwehrmechanismen in Form von Schweigen („eine Mauer um sich bauen“) oder Gegenangriff (Ärger, damit andere Menschen die eigene Verletzbarkeit nicht bemerken) oder ähnliche Verhaltensmuster werden nicht mehr benötigt, sobald eine Akzeptanz der eigenen Stärken und Schwächen vorliegt. Das Annehmen durch sich selbst steht so im Vordergrund, Vertrauen in sich und eigene Fähigkeiten wächst. Allein die Vorstellung, ein Ziel erreicht zu haben, aktiviert. Die Körperhaltung ändert sich, so dass dieses dann auch nonverbal ins Außen kommuniziert wird. Dazu gehört das liebevolle Eingeständnis: „Ich bin gut so, wie ich bin.“ „Ich darf – genau wie andere Menschen – Fehler machen.“ „Ich darf mir Gutes tun.“ Sich in seinem Selbst anzunehmen und wertzuschätzen bedeutet einen sorgsamen Umgang mit dem eigenen Ich. Individuelle Grundannahmen, Glaubenssätze und Normen können mit Hilfe des Psychotherapeuten aufgedeckt und verändert werden, um so zu einem insgesamt zufriedeneren Selbsterleben zu gelangen – verbunden auch mit der Erkenntnis, dass Eigenlob nicht stinkt, sondern motiviert.