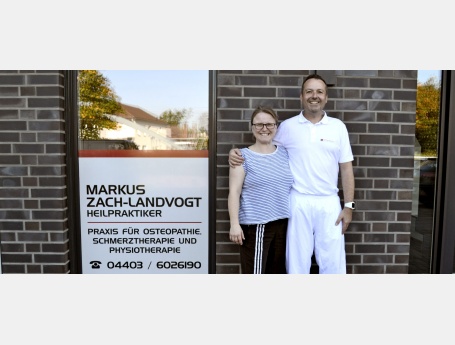Allgemeine Gesundheit
>Verdacht auf Behandlungsfehler, Patientenakte und Patientenquittung

Verdacht auf Behandlungsfehler, Patientenakte und Patientenquittung
Menschen sind fehlbar. Das ist auch im medizinischen Bereich nicht anders. So kann auch eine Diagnose im Einzelfall fehlerhaft sein, genauso wie eine Behandlung. Ob ein Behandlungsfehler vorliegt oder nicht, ist oft sehr schwierig zu beurteilen. Denn medizinische Sachverhalte und Behandlungen sind sehr komplex und häufig schwer zu verstehen. Sollten Sie einen Behandlungsfehler vermuten, gibt es verschiedene Möglichkeiten vorzugehen. Sind für den Arzt Umstände erkennbar, die die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen, hat er den Patienten über diese auf Nachfrage oder zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren zu informieren. Vermuten Sie einen Behandlungsfehler, sprechen Sie offen mit der verantwortlichen Ärztin oder dem verantwortlichen Arzt darüber. Unbegründete Zweifel können sich so ausräumen lassen. Ihre Krankenkasse ist ein wichtiger Ansprechpartner bei einem Verdacht auf einen Behandlungsfehler. Sie ist verpflichtet, ihre Mitglieder bei der Verfolgung von Schadensersatzansprüchen zu unterstützen. So können Sie beispielsweise kostenlos ein Sachverständigengutachten des Medizinischen Dienstes einholen. Dieser prüft, ob tatsächlich ein Fehler vorliegt. Hilfe bekommen Sie auch von der Unabhängigen Patientenberatung (UPD) sowie von Verbraucherzentralen und Selbsthilfeorganisationen. Die Ärzteschaft selbst hat Einrichtungen gegründet, die Patientinnen und Patienten bei der Klärung eines Behandlungsfehlerverdachts unterstützen. Diese Gutachterkommissionen oder Schlichtungsstellen sind meistens bei der jeweils zuständigen Landesärztekammer oder der Landeszahnärztekammer eingerichtet. Sollte sich der Verdacht auf einen Behandlungsfehler erhärten, steht Ihnen der Rechtsweg offen - mit entsprechenden Forderungen auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld. Es gibt speziell ausgebildete Fachanwälte für Medizinrecht oder Juristen mit entsprechendem Themenschwerpunkt, an die Sie sich wenden können. Ist das Verfahren erfolgreich, muss der verurteilte Arzt die Kosten des Verfahrens und auch die Anwaltskosten übernehmen. Grundsätzlich gilt: Die Beweislast trägt der Patient. Außerdem muss der Behandlungsfehler die Ursache des Schadens sein. Häufig ist dieser Zusammenhang nur schwer zu belegen. Deswegen trägt der Arzt in bestimmten Fällen die Beweislast, etwa, wenn er besonders gravierend gegen medizinische Standards verstoßen, bspw. ein falsches Organ entnommen hat oder notwendige Befunde nicht oder falsch dokumentiert hat. Ansprüche auf Schadensersatz oder Schmerzensgeld sollten Sie nicht zu lange aufschieben - sie verjähren, mit einigen Ausnahmen, nach drei Jahren. Erhebt der Patient den Vorwurf einer Verletzung der ärztlichen Aufklärungspflicht (Selbstbestimmungsaufklärung), so trägt der Arzt die Beweislast dafür, dass der Patient hinreichend aufgeklärt wurde und somit wirksam eingewilligt hat. Einsicht in die Patientenakte Ärztewissen ist kein Geheimwissen: alle Informationen, die für Behandlung und Weiterbehandlung relevant sind, müssen in einer Patientenakte festgehalten werden - zeitnah und vollständig. Ärzte sind verpflichtet, alle medizinischen Aspekte, wie die Krankengeschichte, Diagnosen, Untersuchungen und deren Ergebnisse, medikamentöse Therapien und ihre Wirkungen zu erfassen. Auch Eingriffe, Aufklärungen, Einwilligungen sowie Arztbriefe sind aufzuführen. Patientinnen und Patienten können ihre Akte jederzeit einsehen. Es gibt jedoch Ausnahmen. Etwa, wenn ein Verdacht auf Suizid besteht. Grundsätzlich muss eine solche Entscheidung aber begründet werden. Auf Wunsch muss das Fachpersonal die Unterlagen kopieren oder auf einem Datenträger zur Verfügung stellen. Das kann kostenpflichtig sein. Die Akte muss nach Abschluss der Behandlung zehn Jahre lang aufbewahrt werden. Verstirbt der Patient, haben Angehörige beziehungsweise Erben Einsichtsrecht in die Akte. Ausnahme: Der Verstorbene hat dem ausdrücklich oder mutmaßlich widersprochen. Die Dokumentation ist sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form zulässig. Elektronische Patientenakten müssen mit entsprechender Software vor Manipulation geschützt werden. Die Patientenquittung Anders als Mitglieder einer privaten Krankenversicherung, die die Abrechnungen vom Arzt oder Krankenhaus direkt erhalten, erfahren Mitglieder einer gesetzlichen Krankenkasse nicht automatisch, welche Leistungen der Arzt abrechnet und welche Kosten damit verbunden sind. Was viele nicht wissen: nach § 305 Abs. 2 SGB V können Sie vom Arzt, Zahnarzt oder ihrem Krankenhaus eine Patientenquittung mit Kosten- und Leistungsinformationen in verständlicher Form erhalten. Diese können Sie sich vom behandelnden Arzt entweder direkt im Anschluss an die Behandlung oder nach Ablauf des Abrechnungsquartals ausstellen lassen. Achtung: Dafür fällt eine Aufwandspauschale von 1,- Euro an. Möchten Sie die Patientenquittung per Post zugeschickt bekommen, müssen Sie auch die Versandkosten übernehmen. Auch die gesetzlichen Krankenkassen erstellen auf Antrag Informationen über die von Ihnen in den letzten 18 Monaten in Anspruch genommenen Leistungenn und deren Kosten - nach $ 305 Abs. 1 SGB V. DAS PATIENTENRECHTEGESETZ Im Februar 2013 trat das Patientenrechtegesetzt (PRG) in Kraft. Die bis dahin gültige Rechtssprechung wurde in einem neuen Unterkapitel des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zusammengefasst und konkretisiert und zugleich die Patientenrechte im Fünften Sozialgesetzbuch (SGB V) ergänzt und erweitert. Zwar hatten Patienten in Deutschland zuvor auch Rechte und Pflichten. Ein Großteil dieser Rechte war jedoch nicht gesetzlich festgeschrieben, sondern gründete auf dem sogenannten Richterrecht, der Rechtsprechung. Es war deshalb sehr schwierig, sich einen Überblick über die Rechte und Ansprüche der Patienten zu verschaffen. Durch das Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten - dem sogenannten Patientenrechtegesetz sind die verstreuten Patientenrechte erstmals gebündelt worden. Zudem ist die Stellung des Patienten im Gesundheitssystem gestärkt worden. Das Gesetz kommt nicht nur Patientinnen und Patienten zugute. Auch Ärztinnen und Ärzte haben seitdem mehr Rechtssicherheit.