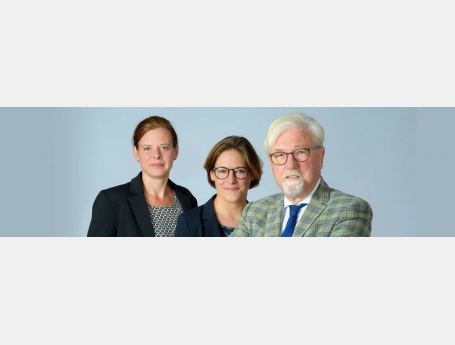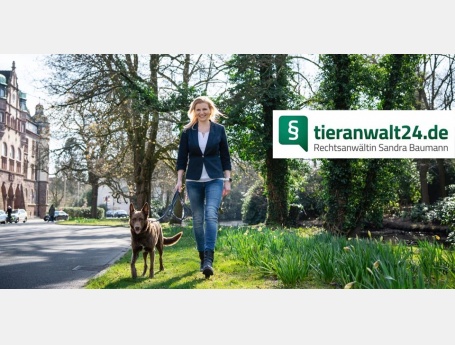„Wildes“ Plakatieren – strafbar und teuer
Wer kennt das nicht: Plakate prägen zunehmend unser Straßenbild. Und das nicht mehr nur zu Wahlkampfzeiten, wo die diversen Wahlkandidaten von allen Wänden lächeln oder zu Feiertagen wie dem 1. Mai, sondern tagtäglich. Hier findet eine Party statt, dort ein Konzert und woanders eine Diskussion oder Demonstration. Und häufig werden diese Plakate nicht nur an Flächen angebracht, an denen die Veranstalter auch ein Nutzungsrecht haben. Da müssen Hauswände, Verteilerkästen, Mauern und Zäune herhalten. Da wird gekleistert auf Teufel komm raus. Für manch einen Anwohner ein ewiges Ärgernis. Denn leider gestaltet sich das spätere Entfernen der Plakate nicht immer problemlos. Es kostet nicht nur Zeit und Mühe, sondern beschädigt oft noch das darunterliegende Mauerwerk, den Anstrich oder das Metall. Der Kleister leistet ganze Arbeit. „Ist das eigentlich strafbar?“, mag sich da so mancher fragen. Nun, es kommt drauf an. In jedem Fall ist das sog. „wilde“ Plakatieren auf fremdem Eigentum oder im öffentlichen Raum kein Kavaliersdelikt. Ohne Erlaubnis des Eigentümers stellt es vielmehr eine Sachbeschädigung gemäß § 303 StGB dar. Hier droht eine Geld- oder gar Haftstrafe von bis zu zwei Jahren. Und dies gilt nicht nur in Fällen, in denen Sachen zerstört werden. Schon das Beschädigen von Sachen ist strafbar. Für die „wilden“ Plakatierer bedeutet das: lässt sich das Plakat nicht ohne Aufwand binnen kurzer Zeit entfernen und bröckelt dann auch noch Mauerwerk ab, liegt eine Sachbeschädigung vor. Und bei den verwendeten Kleistern ist dies meist der Fall. Auch zivilrechtlich ist das „wilde“ Plakatieren interessant: Hier kann es richtig teuer werden. So kann der Eigentümer beispielsweise diejenigen Reinigungskosten als Schadensersatz erstattet verlangen, die durch das Entfernen des Plakates entstanden sind. Und um weiteres Plakatieren zu verhindern, kann er daneben auch einen Unterlassungsanspruch durchsetzen. Werden dann trotzdem erneut Plakate an seine Mauer gekleistert, droht ein Ordnungsgeld im fünf- bis sechsstelligen Bereich! Übrigens: Hat der geschädigte Eigentümer für die Abgabe der Unterlassungserklärung einen Anwalt beauftragt, gehören diese Gebühren dann auch zum Schadensersatz. Doch wer hat eigentlich diese Kosten zu tragen? Gegen wen kann der Betroffene vorgehen? Den Plakatierer selbst wird man in der Regel kaum ermitteln können. Also richten sich die Ansprüche gegen den Veranstalter als sog. „mittelbaren Handlungsstörer“. Das bedeutet, dass er, weil er die Verteilung der Plakate veranlasst hat und damit auch erst die Möglichkeit des „wilden“ Plakatierens eröffnet hat, auch für die Folgen verantwortlich ist. Grundsätzlich könnte er sich dadurch entlasten, dass er den Plakatierer benennt. Ob sich dieser wirklich ermitteln lässt, ist die Frage. Im Idealfall hätte der Geschädigte dann zwei Anspruchsgegner für seinen Schadensersatzanspruch. Autorinnen: Christiane Reuter-Wetzel ist Rechtsanwältin und im Schadens-, Verkehrs- und Bußgeldrecht tätig. Tel.: 0441 / 36 13 86 - 0 ( www.reuter-wetzel.de ). Cathérine Jansen ist Rechtsreferendarin in der Strafrechtskanzlei RA Landowski ( www.rechtsanwalt-landowski.de ).
Wurde auf Ampelpfosten, Verteilerkästen oder Bushaltestellen, also kommunalen Einrichtungen gekleistert, droht ein Bußgeld der Stadt oder Gemeinde wegen einer Ordnungswidrigkeit. Wenn dann noch eine kommunale Verordnung die Möglichkeit vorsieht, dem Verantwortlichen eine gebührenpflichtige Beseitigungsanordnung aufzubrummen und er dieser nicht nachkommt, wird’s noch teurer: Hinzu kommen die Kosten der städtischen Beseitigung. Es ist also festzustellen, dass dem „wilden“ Plakatieren rechtliche Mittel entgegengesetzt werden können. Mit Aussicht auf Erfolg!