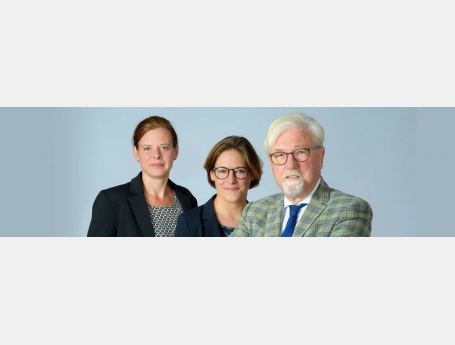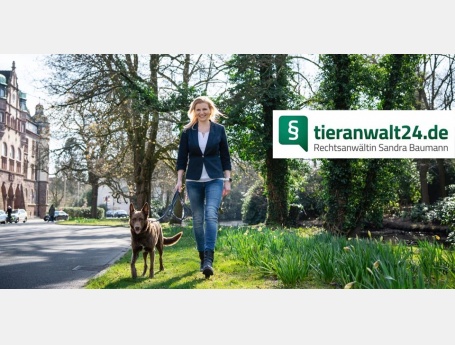Warenversand im Internet
Nicht jede Bestellung im Internet läuft problemlos oder sorgt beim Käufer für Zufriedenheit. Es stellt sich die Frage, wer das Risiko trägt, wenn die Ware auf dem Weg zum Vertragspartner beschädigt wird oder verloren geht. Muss der Käufer zahlen oder muss der Verkäufer nochmals liefern, wenn der Käufer keine Ware erhalten hat? Und gleiches gilt für die Frage der Risikotragung, wenn der Käufer die erhaltene Ware an den Verkäufer zurücksendet. Beim Kaufvertrag hat der Verkäufer dem Käufer die Ware frei von Sach- und Rechtsmängeln zu übergeben und ihm Eigentum zu verschaffen, der Käufer hat die Ware anzunehmen und dem Verkäufer den Kaufpreis zu übereignen. Autor. Alexander Mühlbauer, Rechtsanwalt – LL.M. (Information Law) – Fachanwalt für IT-Recht und Fachanwalt für Strafrecht, Oldenburg, mit zivil- und strafrechtlicher Ausrichtung und zusätzlichen Schwerpunkten im IT-, Urheber- und Medienrecht.
Wenn Käufer und Verkäufer nichts anderes vereinbart haben und sich aus den Umständen nichts anderes ergibt, ist die Holschuld der gesetzliche Regelfall. Bei dieser muss der Gläubiger die Ware beim Schuldner an dessen Sitz abholen. Vielfach regeln jedoch Allgemeine Geschäftsbedingungen dies anders.
Kauft ein privater Käufer bei einer privaten Internetauktion oder ein Unternehmer bei einem Onlineshop, versendet der Verkäufer die Ware meist auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers. Hier geht die Gefahr des zufälligen Untergangs bereits mit der Übergabe an die Post an einen Paket- oder Kurierdienst bzw. an eine Spedition auf den Käufer über. Der Verkäufer muss die Ware nur gut verpacken und diese an ein Transportunternehmen übergeben. Wird die Ware beschädigt oder geht sie verloren, trägt der Käufer das Risiko. Er muss dann trotzdem den Kaufpreis zahlen.
Wenn der private Käufer hingegen bei einem Händler bestellt (sog. Verbrauchsgüterkauf), dann trägt dieser das Risiko des Verlustes. Das bedeutet, dass die verloren gegangene Ware nicht erneut geliefert wird, der Kunde aber auch nicht zahlen muss. Der Verkäufer trägt das Risiko des zufälligen Untergangs. Im Unterschied zum privaten Käufer hat der Unternehmer mehr Einfluss auf die Warenbeförderung, weshalb er das Versendungsrisiko tragen soll. Der Händler kann sich von dieser Risikozuweisung des Gesetzgebers nicht befreien, weshalb abweichende Regelungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sind. Kommt es beim Verbrauchsgüterkauf im Internet zu einem Widerruf des Kaufvertrages, trägt der Verkäufer das Risiko, dass die Ware auf dem Rückweg verloren geht.