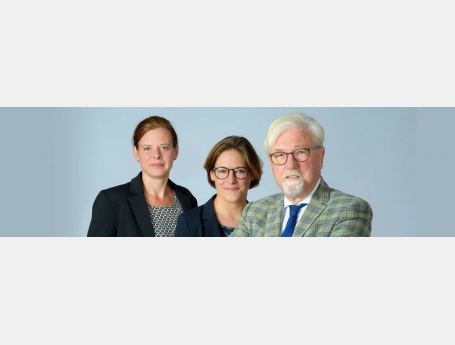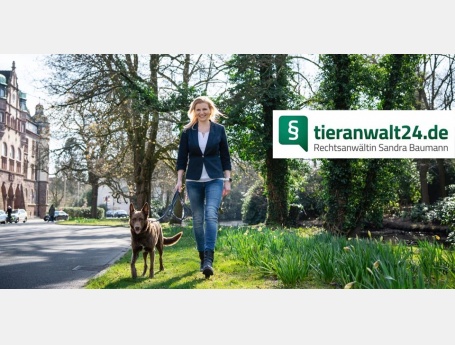„Wahlleistungen“ per Gesetz geregelt
Viele Patienten schließen für ihre Behandlung im Krankenhaus eine Wahlleistungsvereinbarung ab („Chefarztbehandlung“). Die Berechtigung zur Liquidation solcher privatärztlichen Leistungen („Wahlleistungen“) im Krankenhaus ist im Krankenhausentgeltgesetz KHEntgG geregelt. Mit Urteil vom 16.10.2014, Az. III ZR 85/14, hat der Bundesgerichtshof (BGH) den Umfang der hiernach bestehenden Liquidationsbefugnis konkretisiert. Die Entscheidung hatte gravierende Konsequenzen für die Abrechnung eines behandelnden Honorararztes für seine Leistungen. Autor dieses Beitrags: Dr. Daniel Hoffmann, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht. Weiterer Interessenschwerpunkt im Umweltrecht. Kanzlei Hoffmann, Schloßplatz 21, Oldenburg; Telefon: 0441 / 26 501, E-Mail: info@hoffmann-oldenburg.de , Internet: www.hoffmann-oldenburg.de .
Honorarärzte sind Ärzte, die aufgrund einer Kooperationsvereinbarung Leistungen im ambulanten oder stationären Bereich eines Krankenhauses erbringen, ohne bei diesem angestellt zu sein oder als Beleg- oder Konsiliararzt tätig zu werden. Hintergrund solcher Kooperationen ist beispielsweise, dass Krankenhäuser so ihr medizinisches Leistungsangebot erweitern können. Im konkreten Fall hatte eine Patientin für ihre Behandlung mit dem Krankenhaus eine Wahlleistungsvereinbarung abgeschlossen, mit dem Honorararzt hatte sie zusätzlich eine „Vereinbarung über die Behandlung gegen Privatabrechnung“ getroffen. Nach Abschluss der Behandlung liquidierte der Arzt seine Leistungen im Wege der privatärztlichen Vergütung. Hiergegen klagte die private Krankenversicherung der Patientin. Der BGH gab der Versicherung recht und verurteilte den Arzt zur Rückzahlung des privatärztlichen Honorars.
Nach Auffassung des BGH legt § 17 Abs. 3 Satz 1 KHEntgG den Kreis der liquidationsberechtigten Wahlärzte abschließend fest, hiervon abweichende Vereinbarungen sind nichtig. Daher war der beklagte Honorararzt im vorliegenden Fall nicht zur Abrechnung privatärztlicher Leistungen gegenüber der Patientin berechtigt.
Der BGH begründet seine Auffassung damit, dass ein Patient sich über die Wahlleistungsvereinbarung gegen Zahlung eines zusätzlichen Honorars die persönliche Zuwendung und Qualifikation eines Chefarztes zusichere. Der Kreis der hierfür in Betracht kommenden Ärzte werde durch § 17 Abs. 3 Satz 1 KHEntgG festgelegt. § 17 Abs. 3 KHEntgG sieht vor, dass alle an der Behandlung des Patienten beteiligten angestellten oder verbeamteten Ärzte des Krankenhauses, die zur Berechnung ihrer Leistungen vom Krankenhaus berechtigt sind, von der Wahlleistungsvereinbarung erfasst werden. Darüber hinaus erstreckt sich die Wahlleistungsvereinbarung auf Leistungen von Ärzten oder Einrichtungen außerhalb des Krankenhauses, die von diesen Krankenhausärzten bei der Behandlung des Patienten hinzugezogen werden. § 17 Abs. 3 Satz 1 KHEntgG erfasse daher nicht alle an der Behandlung beteiligten Ärzte, sondern nur bestimmte.
Vorliegend war der beklagte Honorararzt weder bei dem Krankenhaus angestellt, noch sei er anderweitig ausdrücklich in die Wahlleistungsvereinbarung aufgenommen worden. Der Beklagte wurde auch nicht auf Veranlassung eines angestellten oder beamteten Krankenhausarztes in die Behandlung einbezogen. Vielmehr stellte seine Leistung die vom Krankenhaus aus dem Behandlungsvertrag geschuldete Hauptleistung dar, die der Arzt aufgrund der Kooperationsvereinbarung gegenüber dem Krankenhaus erbracht habe. Die Behandlung erfolgte daher nicht „außerhalb“ des Krankenhauses, so dass der Arzt die Voraussetzungen des § 17 Abs. 3 KHEntgG insgesamt nicht erfüllte.
Aus der gesonderten Vereinbarung über die Privatliquidation konnte der Beklagte ebenfalls kein Entgelt fordern. § 17 Abs. 3 Satz 1 KHEntgG lege den Kreis der liquidationsberechtigten Wahlärzte abschließend fest. Die Regelung stelle zwingendes Recht dar und könne nicht durch abweichende Vereinbarungen mit dem Patienten umgangen werden. Solche Vereinbarungen sind nach Auffassung des BGH nichtig.
Der BGH führt hierzu im Wesentlichen aus, § 17 Abs. 3 Satz 1 KHEntgG schließe seinem Wortlaut nach die Abrechnung wahlärztlicher Leistungen durch selbstständige Honorarärzte aus. Eine zusätzliche Abrechnungsvereinbarung zwischen dem Patienten und dem Wahlarzt widerspreche dem gesetzlichen Zweck: der Patient wolle sich über die Wahlleistungsvereinbarung den zusätzlichen Qualitätsstandart einer Chefarztbehandlung hinzukaufen, den der externe Honorararzt nicht „per se“ decke.
Der Zweck der Wahlleistungsvereinbarung könne nicht darauf beschränkt werden, einem Arzt das Recht der unmittelbaren Privatliquidation gegenüber dem Patienten zu verschaffen. Der Gesetzgeber habe den Kreis der liquidationsberechtigten Wahlärzte kontinuierlich eingeengt und wollte Drittärzten kein Liquidationsrecht einräumen, wenn sie ihre Leistung ohne Veranlassung eines (liquidationsbefugten) Krankenhausarztes erbringen. Seit der Änderung des KHEntgG zum 1. Janura 2013 können nicht-festangestellte Ärzte zwar allgemeine Krankenhausleistungen ausführen. Hinsichtlich der wahlärztlichen Leistungen habe der Gesetzgeber eine Erweiterung der Leistungsbefugnis aber nicht vorgesehen.
Nicht abschließend klärt der BGH allerdings die für Patienten und Ärzte gleichermaßen wichtige Frage, wie ein Patient, der die Behandlung durch einen bestimmten, nicht am Krankenhaus angestellten Arzt wünscht, sich die Behandlungsleistung versprechen lassen kann und der Arzt im Gegenzug rechtssicher seinen Honoraranspruch behält. In der Entscheidung klingt jedoch an, dass der Honorararzt in diesem Fall als sog. „gewünschter“ Vertreter durch gesonderte Vereinbarung in die Wahlleistungsvereinbarung einbezogen werden könnte.