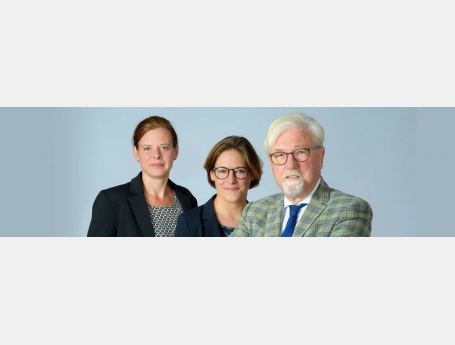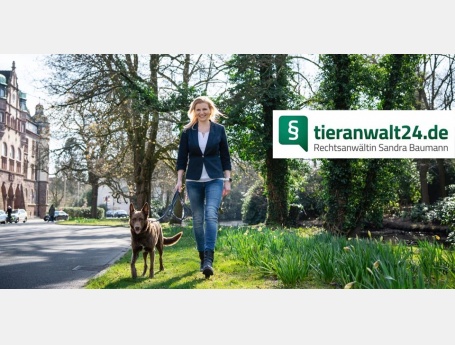Verjährungsfristen – alles ganz schön kompliziert
Eine rechtskräftig verhängte Strafe oder Anordnung einer Maßnahme darf nach Ablauf der Verjährungsfrist nicht mehr geahndet und vollstreckt werden. So steht es in den §§ 78, 79 Abs. StGB. Allerdings ist es bis dahin ein weiter Weg, gepflastert mit zahlreichen Ausnahmeregelungen und Besonderheiten. Die Verjährungsfristen sind in § 78 StGB aufgeführt. Zunächst einmal: Lebenslange Freiheitsstrafen verjähren nicht. Deswegen kann ein Mörder in der Tat sein Leben lang für sein unter Umständen lange zurückliegendes Verbrechen verurteilt werden, was im Zuge der immer verfeinerten DNA-Methoden heutzutage gar nicht mehr so selten vorkommt. Im Übrigen richtet sich die Verjährungsfrist nach der Höhe der angedrohten Strafe und beträgt bei Freiheitsstrafen von mehr als zehn Jahren – 25 Jahre, bei Freiheitsstrafen von mehr als fünf Jahren bis zu zehn Jahren – 20 Jahre, zehn Jahre bei Freiheitsstrafen von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren, fünf Jahre bei Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr oder bei Geldstrafen von mehr als 30 Tagessätzen und drei Jahre bei Geldstrafen bis zu 30 Tagessätzen. Unter bestimmten Voraussetzungen, die in § 78 b StGB geregelt sind, ruht aber die Verjährung, d.h. der Fristablauf wird gehemmt. Dies hat schlicht und einfach den Zweck, den zeitlichen Spielraum für die Strafverfolgungsbehörden zu vergrößern. In der Praxis ist dies von großer Bedeutung für alle Sexualstraftaten und unter bestimmten Voraussetzungen auch für Körperverletzungsdelikte. Hier beginnt die Verjährungsfrist erst mit der Vollendung des 18. Lebensjahres des Opfers. Auch geregelt sind dort die Fälle, in denen sich der Täter zunächst einmal im Ausland in Sicherheit gebracht hat. Hier ruht die Verjährung u.a. sobald ein Auslieferungsgesuch dem jeweiligen Staat zugestellt wurde bis zur Übergabe des Gesuchten an die deutschen Behörden. Eine weitere Besonderheit wird in § 78 c StGB geregelt: Danach wird die Verjährung unterbrochen durch die erste Vernehmung eines Beschuldigten, jede richterliche Vernehmung oder Anordnung, die Beauftragung eines Sachverständigen zur Untersuchung des Beschuldigten, Beschlagnahme oder Durchsuchungsanordnungen, Haftbefehle, die Erhebung der Anklage, die Eröffnung des Hauptverfahrens, Anberaumung eines Hauptverhandlungstermines, Strafbefehle, eine vorläufige Einstellung des Verfahrens wegen Abwesenheit des Angeschuldigten oder wegen Verhandlungsunfähigkeit des Angeschuldigten und zu guter Letzt durch jedes richterliche Ersuchen, eine Untersuchungshandlung im Ausland vorzunehmen. Im Falle einer solchen Unterbrechung verlängert sich der Verjährungseintritt entsprechend, d.h. die bisher abgelaufene Verjährungsfrist gilt nicht mehr und die Frist beginnt erneut zu laufen. Allerdings kann die Frist nicht etwa durch wiederholte Beschuldigtenvernehmungen in entsprechenden zeitlichen Abständen bis ultimo verlängert werden. Dies verhindert die sogenannte absolute Verjährung: Nach Verstreichen des doppelten der gesetzlichen Verjährungsfrist tritt die Verjährung automatisch ein. Schon durch diesen flüchtigen Exkurs in die komplexe Materie wird aber deutlich, dass der Täter nur dann darauf vertrauen kann, dass er straffrei ausgeht, wenn die Tat erst nach Ablauf der Verjährungsfrist überhaupt entdeckt wird. Autorin: Kirsten Hüfken, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht, Oldenburg, Tel.: 0441 / 27 621; Mitglied des Deutschen Anwaltsvereins, Mitglied im Arbeitskreis Strafrecht des Oldenburger Anwalts- und Notarvereins und Mitglied im Deutsche Strafverteidiger e.V., Oldenburg.