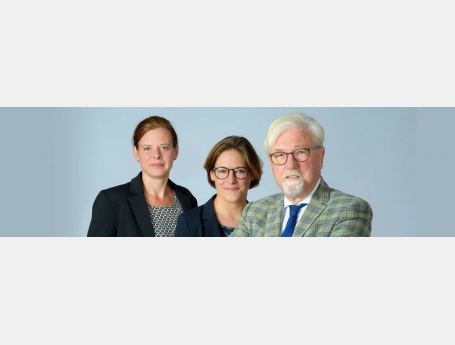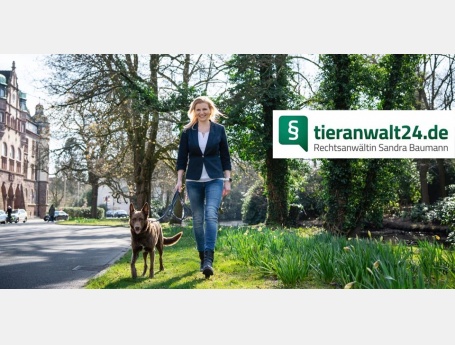Verbotene Vernehmungsmethoden und mögliche Folgen
Die Freiheit der Willensentschließung und Willensbetätigung des Beschuldigten darf nicht beeinträchtigt werden durch Misshandlung, durch Ermüdung, durch körperlichen Eingriff, durch Verabreichung von Mitteln, durch Quälerei, durch Täuschung oder durch Hypnose. Zwang darf nur angewandt werden, soweit das Strafverfahrensrecht dies zulässt. Die Drohung mit einer nach seinen Vorschriften unzulässigen Maßnahme und das Versprechen eines gesetzlich nicht vorgesehenen Vorteils sind verboten.“ So lautet der Wortlaut des § 136 a Abs. 1 StPO (Strafprozessordnung). Weiter heißt es in Absatz 3 Satz 2, dass Aussagen, die unter Verletzung dieses Verbotes zustande gekommen sind, auch dann nicht verwertet werden dürfen, wenn der Beschuldigte der Verwertung zustimmt. Dieser Grundsatz ist vielen von uns in Erinnerung aus einem Frankfurter Prozess wegen Kindesentführung, der nicht nur wegen seines grausamen Tatgeschehens, sondern auch wegen strafprozessualer Besonderheiten Aufsehen erregte. Der Fall Gäfgen wurde insbesondere deswegen in der Öffentlichkeit sehr heftig und kontrovers diskutiert, weil im Ermittlungsverfahren gegen den späteren Angeklagten seitens der Polizei Folterdrohungen ausgesprochen worden waren, um den Aufenthaltsort des entführten – möglicher weise noch lebenden – Kindes zu erfahren. Damals hatte das Bundesverfassungsgericht noch einmal bekräftigt, dass das in § 136 a StPO ausgesprochene Folterverbot absolut gilt und durch keine besonderen Umstände eingeschränkt oder relativiert werden könne. § 136 a StPO dient dem Schutz der Menschenwürde und ist insofern nicht diskutierbar. Dieser Grundsatz hat zur Folge, dass Vernehmungen, die unter verbotenen Methoden zustande gekommen sind, dem Verwertungsverbot unterliegen, das heißt, das Gericht darf das Ergebnis dieser Ermittlungen nicht für seine Beweiswürdigung heranziehen. Unter verbotene Vernehmungsmethoden fällt ausdrücklich eben auch die sogenannte Rettungsfolter, das heißt die Androhung oder gar der Einsatz körperlicher Gewalt gegenüber einer festgehaltenen Person zur Erzwingung von Angaben über den Aufenthaltsort eines Entführten oder sonstige Informationen zur Abwehr von Gefahren für Leib oder Leben. Dies hat im Jahre 2008 der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Fall Gäfgen ausdrücklich entschieden mit der Konsequenz, dass gegen die verantwortlichen Vernehmungsbeamten ermittelt und diese wegen Nötigung im Amt bzw. Anstiftung dazu verurteilt wurden. Dieser restriktiven Auslegung liegt der allgemeine Grundsatz zugrunde, dass die Wahrheit im Strafverfahren eben nicht um jeden Preis, sondern in einem rechtsstaatlich geordneten Verfahren erforscht und erlangt werden soll, eben weil der Schutz der Menschenwürde absolut sei und keine Ausnahmen oder Interessenabwägungen zulasse. Dass Herr Gäfgen dennoch wegen Mordes verurteilt wurde, lag neben der Beweislage im Übrigen auch daran, dass er im Prozess nach einer sogenannten qualifizierten Belehrung erneut ein Geständnis abgelegt hat. Autorin: Kirsten Hüfken, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht, Bremer Str. 29 in Oldenburg, Tel.: 0441 / 27 621.