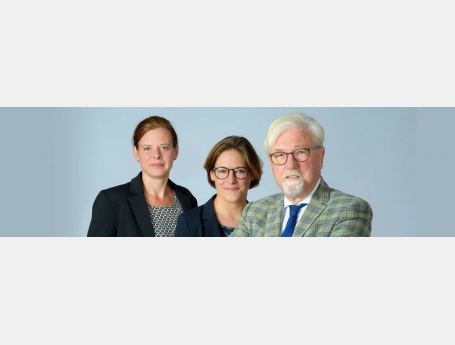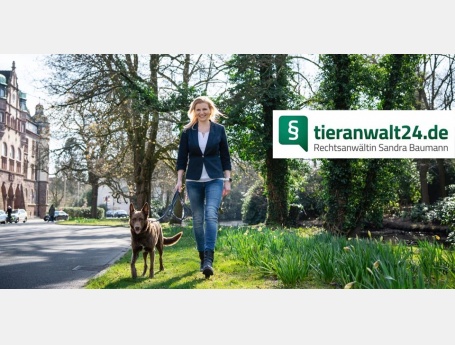Nulla poena sine lege – keine Strafe ohne Gesetz
Dieser Grundsatz wurde bereits von dem Rechtsgelehrten Johann Paul Anselm von Feuerbach (1775-1833) formuliert und besagt, dass eine Tat nur dann bestraft werden kann, wenn sie einem Gesetz oder einer anderen Rechtsvorschrift zugeordnet werden kann. Wörtlich heißt es dazu im Artikel 103 Abs. 2 des Grundgesetzes: „Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.“ Das Grundgesetz verbietet daher in der Konsequenz dem Gesetzgeber, Normen zu schaffen, die nicht hinreichend bestimmt sind und verbietet ihm zugleich, Strafbarkeitslücken durch eigene Auslegung zu schließen. Eine weitere in diesem Zusammenhang wichtige Norm betrifft das Rückwirkungsverbot: „Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn sie schon zur Zeit ihrer Ausführung mit Strafe bedroht war.“ Dieses Rückwirkungsverbot ist ausdrücklich in § 1 StGB normiert. Ganz aktuell wurde dieser Grundsatz im „Fall Edathy“ diskutiert, in dem die Staatsanwaltschaft Hannover im Juli 2014 Anklage wegen des Besitzes von kinderpornografischem Material erhoben hat. Das zuständige Landgericht in Verden eröffnete daraufhin das Hauptverfahren. Offensichtlich teilte es die Auffassung des Angeklagten, dass die Anklageschrift keine tragfähige Grundlage für einen Prozess bildet, nicht. Nachdem die Hannoveraner Staatsanwaltschaft zunächst von „Material im kinderpornografischen Grenzbereich, da keine sexuellen Handlungen, jedoch Genitalien gezeigt werden“, gesprochen – und betont hat, dass Videos und Bilder von nackten Kindern per se noch keine strafbare Kinderpornografie und damit strafrechtlich irrelevant seien, ergaben spätere Recherchen nach Durchsuchungen des Laptops und der Privaträume Bilder angeblich kinderpornografischen Inhalts, eine CD mit angeblich jugendpornografischen Videos sowie Hefte mit angeblich jugendpornografischen Bildern. Autorin dieses Beitrags: Kirsten Hüfken, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht, Oldenburg.
Im November 2014 verabschiedete der Bundestag ein Gesetzespaket, das Kinder besser gegen Kinderpornografie schützen soll. Danach wird nunmehr auch der Verkauf oder Handel mit Nacktbildern von Kindern und Jugendlichen mit bis zu zwei Jahren Haft oder Geldstrafe bestraft. Hätte sich im Rahmen einer Beweisaufnahme in Verden also herausgestellt, dass es sich zum Tatzeitpunkt (zwischen 2005 und 2010) um damals noch strafrechtlich irrelevante Nacktbilder von Kindern gehandelt hat, so hätte dieses nach dem oben zitierten Grundsatz „keine Strafe ohne Gesetz“ logischerweise auch keine Verurteilung nach sich ziehen können.
Zwischenzeitlich wurde das Verfahren gem. § 153 a StPO mit Zustimmung aller Beteiligten gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt, was bedeutet, dass Staatsanwaltschaft und Gericht das gefundene Material auch nach altem Recht – also vor der Gesetzesreform im November 2014 – zwar als strafrechtlich relevant eingestuft, jedoch wegen geringer Schuld des Angeklagten von einer Verurteilung abgesehen haben. Die für eine Einstellung erforderliche und erfolgte Zustimmung auch des Angeklagten zu diesem Abschluss des Verfahrens bedeutet allerdings kein Schuldeingeständnis und kann auch später nicht als solches gewertet werden.
Dennoch wird die Zustimmung der Staatsanwaltschaft und / oder des Gerichts in der Praxis häufig von einem Geständnis oder eben einer Verteidigererklärung abhängig gemacht, obwohl dies prozessual für eine Einstellung nicht erforderlich ist. Eine Einstellung bedeutet für den Betroffenen, dass er weiterhin als nicht vorbestraft gilt.