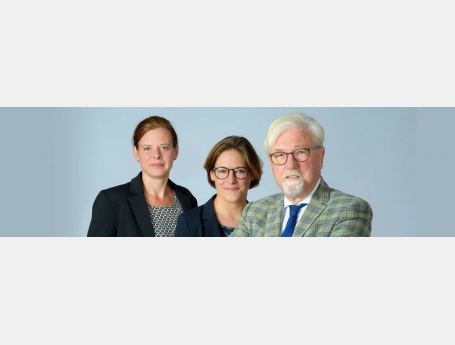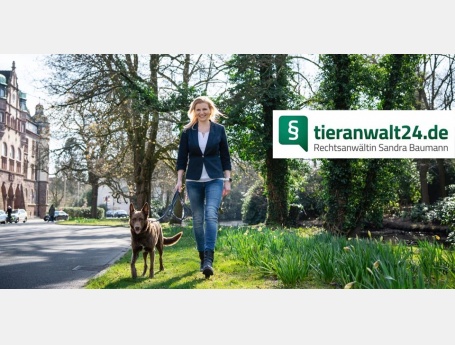Können Sie Ihren Namen schreiben?
Es geht um Ihre Unterschrift. Ein jeder muss im Alltag Schriftstücke unterschreiben und viele Unterschriften sind absolut unleserlich. Das wirft die Frage auf, ob eine solche „Unterschrift“ im Rechtsverkehr als Unterschrift anzuerkennen ist. Durch Gesetz wird für viele Rechtsgeschäfte die schriftliche Form vorgeschrieben. Dann muss gemäß § 126 BGB die Urkunde eigenhändig durch Namensunterschrift unterzeichnet sein (oder es muss das „Handzeichen“ notariell beglaubigt werden). Dies gilt beispielsweise für die Kündigung eines Mietvertrages, für die Kündigung des Arbeitsvertrages, für die Honorarvereinbarung mit dem Architekten und in vielen weiteren Fällen. Derartige Willenserklärungen sind unwirksam (mangels Einhaltung der Schriftform nichtig), wenn sie nicht „eigenhändig durch Namensunterschrift“ unterzeichnet sind. Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte zum Beispiel über folgenden Fall zu entscheiden: Eine Bürgin wurde aus einem Auto-Leasingvertrag in Anspruch genommen und sie wandte ein, dass der Leasingvertrag nicht wirksam unterschrieben worden sei. Ohne Erfolg. Das OLG Frankfurt (Urteil vom 27.04.2005 AZ: 17 U 166/04) bejahte das Vorliegen einer Unterschrift, weil dort drei Buchstaben des Namens zu erkennen waren. Der Autor dieses Artikels: Rechtsanwalt und Notar Josef Arens ist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht aus der Rechtsanwaltskanzlei ARENS & GROLL in Oldenburg, www.ra-arens.de .
Die Schriftform (die Unterschrift) hat den Zweck, die Identität des Ausstellers erkennbar zu machen und dem Empfänger die Prüfung zu ermöglichen, wer die Erklärung abgegeben hat. Es genügt die Unterschrift mit dem Familiennamen (zulässig ist die Unterzeichnung mit einem Teil eines Doppelnamens) Die Unterzeichnung nur mit dem Vornamen genügt nicht (anders nur bei Fürstlichkeiten und Bischöfen oder bei Rechtsgeschäften mit nahen Angehörigen). Keine Namensunterschrift soll vorliegen, wenn die Willenserklärung mit der Verwandtschaftsbeziehung („Euer Vater“) unterschrieben wird.
Auf die Lesbarkeit der Unterschrift kommt es nicht an, jedoch muss der Schriftzug Andeutungen von Buchstaben erkennen lassen. Es muss erkennbar sein, dass es sich nicht um eine Abkürzung handelt. Erforderlich und ausreichend ist ein individueller Schriftzug, der sich als Wiedergabe eines Namens darstellt.
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte darüber zu entscheiden, ob der Rechtsanwalt die von ihm bei dem Oberlandesgericht eingereichte Berufungsbegründung wirksam unterschrieben hatte. Dessen „Unterschrift“ war nicht lesbar und bestand aus „zwei leicht bogenförmigen Strichen, die schleifenförmig am unteren Ende spitz zulaufen und am oberen Ende sich kreuzend auslaufen“, ergänzt mit der maschinenschriftlichen Namensangabe des Rechtsanwalts. Der BGH entschied durch Beschluss vom 11.04.2013 (AZ: VII ZB 43/12), dass die Berufungsbegründung unwirksam sei, weil tatsächlich keine Unterschrift vorliege, auch wenn dieser seit jeher in derselben Weise zu unterschreiben pflegt. Es sei nicht der Versuch erkennbar, dass der Unterzeichner seinen vollen Namen hat schreiben wollen.
Es dürften im Ergebnis viele Rechtsgeschäfte unwirksam sein, in denen die Schriftform vorgeschrieben ist, aber hiernach nicht eingehalten worden ist. Dies ist im Einzelfall zu überprüfen. Zukünftig sollte man seine Unterschrift für Rechtsgeschäfte vorsorglich anpassen und mit seiner Unterschrift jedenfalls „den Versuch erkennen lassen, seinen vollen Namen schreiben zu wollen“ und keine Abkürzung, um keine Rechtsnachteile wegen Fehlens einer wirksamen Unterschrift zu erleiden.