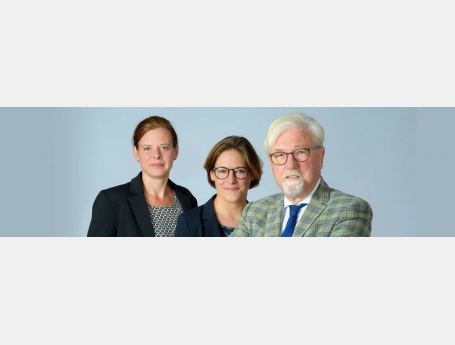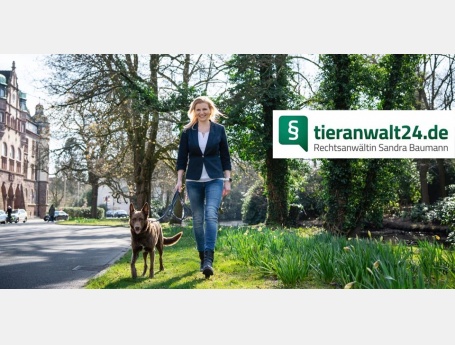Das Problem mit der Ratenzahlung
Die Schuldnerin stand mit der Beklagten in laufender Geschäftsverbindung und bezahlte bereits im Jahr 2003 einen erheblichen Teil ihrer aus Warenlieferungen herrührenden Verbindlichkeiten nicht zum Fälligkeitszeitpunkt. Ihr Zahlungsrückstand belief sich Ende 2003 auf 271 337,56 Euro€. Bis Ende Februar 2004 erhöhte sich die Forderung der Beklagten gegen die Schuldnerin auf 376 481,37 Euro€. Aufgrund einer zwischen der Schuldnerin und der Beklagten im März 2004 getroffenen Vereinbarung sollte die Schuldnerin diese Altverbindlichkeiten durch Ratenzahlungen bis zum 6. Mai 2004 tilgen. Tatsächlich zahlte die Schuldnerin bis zum 22. April 2004 einen Gesamtbetrag von 270 000 Euro an die Beklagte. Die Lastschrift über die am 29. April 2004 fällige Rate in Höhe von 30 000 Euro wurde jedoch nicht eingelöst; die am 6. Mai 2004 fällige Schlussrate wurde seitens der Schuldnerin nicht erbracht. Kurz gefasst kann festgestellt werden, dass der Gläubiger dazu verurteilt wurde, sämtliche Zahlungen, die er ab April 2004 bis zur Insolvenzantragstellung im Juli 2005 in Teilleistungen erhalten hatte, wieder auszukehren, da der Gläubiger aufgrund der Umstände Kenntnis von der Liquiditätssituation seines Schuldners haben musste. Hierfür reicht es gemäß BGH-Urteil vom 19.02.2009 (- IX ZR 62/08 -) bereits aus, wenn der Gläubiger die Liquiditätslage des Schuldners wenigstens laienhaft beurteilen kann. Das sollte unter Geschäftsleuten wohl in der Regel zu erwarten sein. Hinzu kommt eine für den Gläubiger nachteilige Beweislastumkehr: Wenn der Gläubiger wenigstens Kenntnis von Umständen hatte, aufgrund derer er auf eine zumindest drohende Zahlungsunfähigkeit seines später insolventen Geschäftspartners schließen musste, muss nicht der Insolvenzverwalter beweisen, dass der Gläubiger Kenntnis einer Zahlungsunfähigkeit gehabt hat, sondern der Gläubiger muss belegen, dass er eben diese nicht gekannt hat. Anfechtbar ist eine Rechtshandlung, die der Schuldner in den letzten zehn Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder nach diesem Antrag mit dem Vorsatz, seine Gläubiger zu benachteiligen, vorgenommen hat, wenn der andere Teil zur Zeit der Handlung den Vorsatz des Schuldners kannte. Diese Kenntnis wird vermutet, wenn der andere Teil wusste, dass die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners drohte und dass die Handlung die Gläubiger benachteiligte. Sind Ratenzahlungsvereinbarungen künftig überhaupt noch sinnvoll möglich? Als Konsequenz aus dem vorstehend Ausgeführten kann im Grunde nur empfohlen werden: Helfen Sie keinem Geschäftspartner durch Ratenzahlungsvereinbarungen aus der Krise! Sie sind am Ende der Dumme und müssen zur Abwehr des Anfechtungsanspruchs des Insolvenzverwalters beweisen, dass Sie vieles, was man selbstverständlich über seinen Geschäftspartner weiß, nicht gewusst haben. Als Fazit kann festgehalten werden, dass derjenige, der heute eine Ratenzahlungsverpflichtung mit einem Schuldner eingeht, sich damit dem Risiko aussetzt, in den nächsten zehn Jahren im Zuge eines Insolvenzverfahrens gleich aus welchem Grund mit der vollständigen Rückzahlung durch Anfechtung konfrontiert zu werden. Dies ist auch deswegen besonders misslich, weil die Anfechtbarkeit nicht nur erhaltene Ratenzahlungen auf Forderungen wegen einmal erbrachter Leistungen betrifft, sondern auch Zahlungen erfasst, die in einer laufenden Geschäftsbeziehung erbracht werden. Mit anderen Worten: Es ist möglich, dass erhaltene Zahlungen angefochten werden, obwohl dafür seinerzeit unmittelbar Gegenleistungen des Gläubigers (z.B. Warenlieferungen) erbracht wurden. ■ Treffen Sie eine eindeutige, realistisch erfüllbare Ratenzahlungsvereinbarung hinsichtlich der bisher aufgelaufenen Forderungen und stellen Sie sicher, dass bei künftigen Zahlungen klar ist, ob diese auf die Ratenzahlungsvereinbarung oder auf neue Forderungen erfolgen. Autoren dieses Beitrags: Dr. Bernhard Becker, Unternehmer und Partner der comes Unternehmensberatung, Peter Böttger, comes Unternehmensberatung Oldenburg und Dr. Christoph Bode, Rechtsanwalt, Spezialist für Sanierung und Insolvenzrecht in der Partnerschaftsgesellschaft mbB, Hochhäusler Duwe & Partner Rechtsanwälte Steuerberater.
Im gewerblichen Miteinander ist es durchaus üblich, dass sich gewollt auch größere Abhängigkeiten zwischen Kunden und Lieferanten ergeben und dass dabei auch gegenseitig Vertrauen aufgebaut wird. Kurzum, man hilft sich, wenn wirtschaftliche Probleme auftreten. Aber diese bewährte Praxis wird durch die BGH-Rechtsprechung, insbesondere durch ein Urteil vom 06.12.2012 (sog. Nikolausentscheidung – IX ZR 3/12 –) ad absurdum geführt. Hintergrund ist der § 133 der Insolvenzordnung, welcher ursprünglich – nach dem Wortlaut und der Intention des Gesetzgebers – die Ausnahmesituation einer vorsätzlichen Gläubigerbenachteiligung regeln sollte. Durch die Rechtsprechung des BGH hat § 133 InsO aber eine massive Ausweitung seines Anwendungsbereiches erfahren, und insbesondere nach Ergehen des genannten Urteils haben sich viele Insolvenzverwalter aufgemacht, die Masse durch Anfechtung von bis zu 10 Jahren zurückliegenden Sachverhalten zu mehren. Das besondere Interesse der Insolvenzverwalter, die ihnen von der Rechtsprechung gegebenen Anfechtungsmöglichkeiten zu nutzen, erklärt sich daraus, dass jede Mehrung der Insolvenzmasse zu einer Erhöhung ihrer persönlichen Vergütung führt. Dass diese Anfechtungspraxis zu nicht mehr nachvollziehbaren Urteilen gegen viele gutgläubige Gläubiger führt, bleibt unberücksichtigt.
Folgender (gekürzter) Sachverhalt lag dem angesprochenen Urteil vom 06.12.2012 zu Grunde:
Die Schuldnerin und die Beklagte schlossen daraufhin eine weitere – angepasste – Ratenzahlungsvereinbarung. Anfang Oktober 2004 belief sich der Restsaldo auf 57 229,28 Euro€, der bis zum 15. Dezember 2004 auf rund 39 000 Euro reduziert wurde.
Zwecks Begleichung der laufenden Verbindlichkeiten leistete die Schuldnerin Zahlungen, die insbesondere auf Einzelabsprachen zwischen ihr und der Beklagten beruhten. Am 20. Oktober 2004 wurde eine Lastschrift über 10 000 Euro nicht eingelöst.
Im Dezember 2004 sowie im Januar und April 2005 und kam es zu weiteren Lastschriftrückgaben. Im Zeitraum Januar bis Anfang Juli 2005 zahlte die Schuldnerin gleichwohl insgesamt 107 533,06 €Euro an die Beklagte.
Am 25. Juli 2005 erfolgte schließlich die Insolvenzantragstellung.
Rechtlicher Anknüpfungspunkt für diese BGH-Rechtsprechung ist § 133 Abs. 1 InsO:
Das Schaubild auf dieser Seite soll veranschaulichen, wie einfach es heute ist, sich angesichts der vorstehend dargestellten BGH-Rechtsprechung Anfechtungsansprüchen nach § 133 InsO ausgesetzt zu sehen.
Aber es ist fraglich, ob daraus in der Praxis etwas Positives hergeleitet werden kann. Denn wann entspricht eine Ratenzahlungsvereinbarung schon „den Gepflogenheiten des Geschäftsverkehrs“? Und regelmäßig wird die Bitte um die Gewährung einer Ratenzahlung mit einer Begründung versehen sein, welche auf Zahlungsschwierigkeiten des Schuldners hinweist, d.h. die Ratenzahlungsvereinbarung ist normalerweise kein isolierter und neutraler Akt, sondern entspringt der Notwendigkeit einer realen wirtschaftlich schwierigen Situation, die dann wiederum vom anfechtenden Insolvenzverwalter zum Anknüpfungspunkt für eine Vorsatzanfechtung gemäß § 133 InsO gemacht werden kann.
Erwähnt sei in diesem Zusammenhang, dass Ratenzahlungsvereinbarungen von der Rechtsprechung besonders kritisch gesehen werden, wenn sie unter Druck abgeschlossen werden, also z.B. wenn der Gläubiger dem Schuldner mit Zwangsmaßnahmen oder gar der Stellung eines Insolvenzantrages droht.
Die dann vom Schuldner geleisteten Zahlungen werden von der Rechtsprechung in solchen Fällen als sog. (inkongruente) Druckzahlungen qualifiziert, welche von einem Insolvenzverwalter nahezu stets erfolgreich angefochten werden können.
Dass dies an jeder Realität im Geschäftsleben vorbei geht, stört den BGH, der offensichtlich ausschließlich auf eine Mehrung der Insolvenzmasse durch eine Ausweitung der Anfechtungsmöglichkeiten des Insolvenzverwalters fixiert ist, wenig.
Letztlich hilft es dem Gläubiger nur, wenn er Einsicht in die Unterlagen seines Schuldners nimmt und auf dieser Basis – objektiv nachvollziehbar – zu dem Schluss gelangt, dass entweder keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt (bzw. diese durch den Abschluss der angedachten Ratenzahlungsvereinbarung beseitigt wird) oder dass sämtliche Gläubiger des Schuldners exakt gleich behandelt werden. In der Praxis sind diese Anforderungen wohl kaum zu erfüllen!
Da hilft es nur wenig, dass derzeit eine Gesetzesänderung diskutiert wird, die die Anfechtbarkeit nach § 133 InsO entschärfen sollen (z.B. indem der Anfechtungszeitraum von zehn auf vier Jahre verkürzt wird). Denn zum einen ist fraglich, wann und in welcher Form das entsprechende Änderungsgesetz verabschiedet wird. Und zum anderen ist zu erwarten, dass die geänderte – entschärfte – Fassung des § 133 InsO nicht für Insolvenzverfahren gilt, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gesetzesänderung schon eröffnet waren. Abgesehen davon haben Richter des für die Insolvenzanfechtung zuständigen IX. Senats des BGH schon verlauten lassen, dass sie die Intention des Gesetzgebers, eine Entschärfung des § 133 InsO bewirken zu wollen, zu ignorieren gedenken, wenn nur der (geänderte) Wortlaut der Norm dafür Spielräume schafft.
Wenn Sie ungeachtet der aufgezeigten Anfechtungsrisiken gleichwohl eine Ratenzahlungsvereinbarung mit Ihrem Schuldner schließen wollen (z.B. weil Sie mit diesem in einer langjährigen Geschäftsverbindung stehen und ihn in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation schlicht nicht „hängen lassen“ wollen), ist folgende Vorgehensweise anzuraten:
■ Achten Sie insoweit darauf, dass Ihr Schuldner jeweils einen wiederkehrenden, festen Betrag mit einen bestimmten Verwendungszweck (z.B. „Zahlung gem. Zahlungsvereinbarung“) überweist; möglich ist auch ein Rateneinzug im SEPA-Lastschriftverfahren.
■ Wenn die Forderungen gegen den Schuldner kreditversichert sind, ist begleitend eine Absprache mit dem Kreditversicherer zu treffen, wonach diese Verfahrensweise den Versicherungsschutz für die Forderungen, welche mit der Ratenzahlungsvereinbarung bedient werden, nicht entfallen lässt.
■ Neue Leistungen ab der Ratenzahlungsvereinbarung sollten nur noch gegen Vorkasse erbracht werden. Dies gilt dann insolvenzrechtlich als „Bargeschäft“, und die erhaltenen Zahlungen können im Nachhinein vom Insolvenzverwalter nur unter erschwerten Bedingungen angefochten werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Zahlung und die Leistung in einem engen zeitlichen Rahmen, welcher zwei Wochen nicht übersteigen soll, erfolgen
■ Wenn Ihr Schuldner die Ratenzahlungsvereinbarung nicht einhält oder wenn es zum Auflaufen neuer Rückstände kommt bzw. keine Vorkassezahlung erfolgt, sollten die Leistungen an ihn eingestellt werden, da dann das Risiko einer Anfechtung der noch erhaltenen Zahlungen durch einen späteren Insolvenzverwalter zu groß ist.
■ Und schließlich: Dokumentieren Sie nicht in Schrift- oder E-Mail-Verkehr, dass Sie Kenntnis von den schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen Ihres Geschäftspartners haben. Unterlassen Sie es insbesondere, mit Zwangsmaßnahmen oder gar der Stellung eines Insolvenzantrages zu drohen.