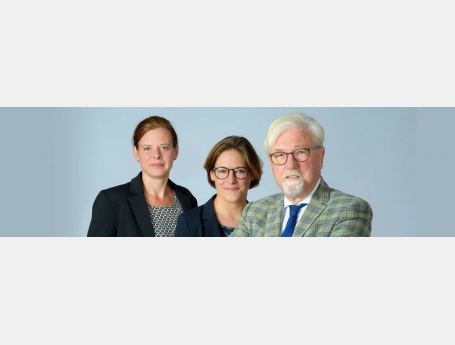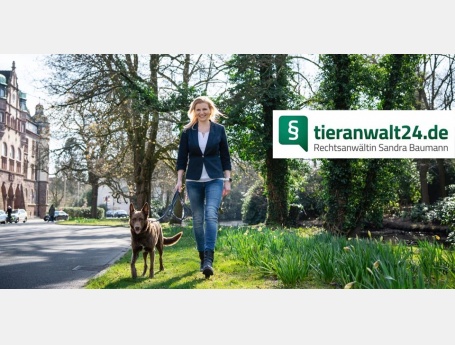15 Jahre als Mindestmaß
Nach § 38 StGB ist eine Freiheitsstrafe „zeitig“, wenn das Gericht nicht lebenslange Freiheitsstrafe androht. Das Höchstmaß der zeitigen Freiheitsstrafe beträgt 15 Jahre, ihr Mindestmaß einen Monat. Nach § 57 a Abs. 1 Satz Nr. 1 StGB kann das Gericht die Vollstreckung des Restes einer lebenslangen Freiheitsstrafe frühestens zur Bewährung aussetzen, wenn der Verurteilte 15 Jahre der Strafe verbüßt hat. Mit dieser Zeitspanne soll zum einen ein deutlicher Abstand zu den Aussetzungsmöglichkeiten bei zeitigen Freiheitsstrafen gewahrt bleiben, andererseits soll dem Verurteilten eine Perspektive gegeben werden, die seine Resozialisierung im Anschluss noch zulässt. Andererseits kann aber mitnichten jeder zu lebenslänglich verurteilte Täter die Gewissheit haben, nach 15 Jahren wieder in die Freiheit entlassen zu werden. Für die Aussetzung des Strafrestes eines zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verurteilten ist weiterhin eine positive Legalprognose erforderlich. Dazu bedarf es der Stellungnahme eines Gutachters, zum einen hinsichtlich der durch die Tat zu Tage getretenen Gefährlichkeit, des Weiteren fließen in die Beurteilung das Vollzugsverhalten insbesondere während der Vollzugslockerungen ein. Weiter muss Gegenstand des Gutachtens die Frage sein, ob von dem Verurteilten künftig keine Gefahr der Begehung weiterer Straftaten mehr ausgeht, was bedeutet, dass die Gefahr eines neuen schweren Verbrechens mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen ist. (Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es nun mal leider nicht!). Weigert sich der Verurteilte aber z.B. im Falle eines begangenen Raubmordes beharrlich, Auskunft über den Verbleib der Tatbeute zu geben, so kann das Gericht ebenfalls von der Aussetzung des Strafrestes absehen. Autorin: Kirsten Hüfken, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht, Oldenburg; Tel.: 0441 / 27 621.
Das heißt aber keineswegs zwangsläufig, dass lebenslänglich wirklich lebenslänglich bedeutet.
Die Aussetzung hat nach dem Gesetz dann zu unterbleiben, wenn die besondere Schwere der Schuld des Verurteilten die weitere Vollstreckung gebietet. Grund für diese Regelung ist, dass der Gesetzgeber der Meinung ist, dass es nicht gerecht sein kann, für alle zur Höchststrafe Verurteilten ohne Rücksicht auf das Maß ihrer Schuld den Aussetzungszeitpunkt gleich festzusetzen. (Mord ist nicht gleich Mord). In der Praxis bedeutet dies, dass ein grausamer Massenmörder eine höhere Strafe verdient als derjenige, der sich möglicherweise unter besonderen Umständen zu einem Mord hat hinreißen lassen.
Die Feststellung zur besonderen Schuldschwere muss bereits im Urteil erfolgen. Was dies für die Verbüßungsdauer bedeutet, legt später das Vollstreckungsgericht fest. Die Verlängerung der Verbüßungszeit erfolgt aber in der Regel erst zeitnah vor Ablauf der an sich üblichen 15 Jahre.
Weiterhin gilt der Grundsatz, dass lebenslänglich nur einmal verhängt werden kann, weil der Täter eben nur ein Leben hat. Begeht er aber etwa beispielsweise im Strafvollzug einen weiteren Mord, so hat er bei einer erneuten Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe zumindest weitere 15 Jahre zu verbüßen.
Weitere Voraussetzungen für die Strafaussetzung ist die Einwilligung des Verurteilten. Stimmt dieser nicht zu, so hat die Aussetzung zu unterbleiben. Liegen jedoch alle Voraussetzungen vor, so hat die Aussetzung von Amts wegen zu erfolgen, wobei die Entscheidung darüber so rechtzeitig fallen sollte, dass der Justizvollzugsanstalt genügend Spielraum für geeignete Entlassungsvorbereitungen bleibt.