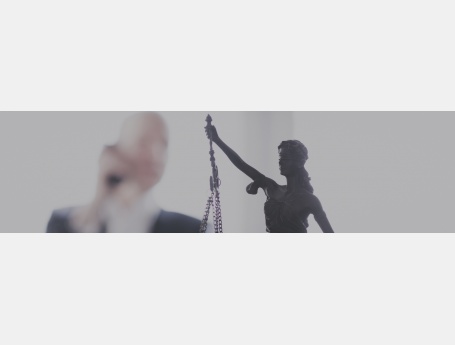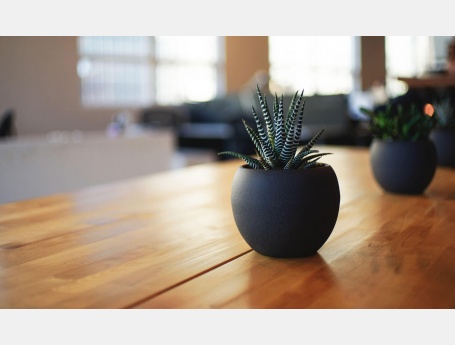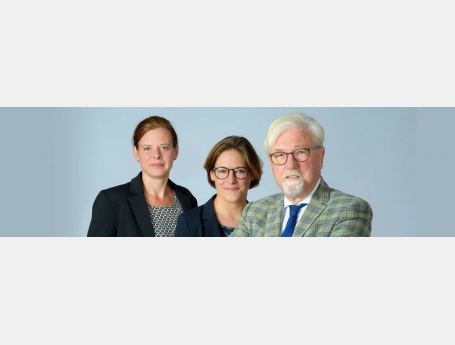Aussage gegen Aussage-Konstellation
Eine besondere Glaubwürdigkeitsprüfung des Zeugen ist erforderlich
Derartige Fälle sind für alle Beteiligten besonders schwierig. Für den Beschuldigten, dem unter Umständen eine mehrjährige Freiheitsstrafe droht. Für den Zeugen, der möglicherweise tatsächlich Opfer einer Straftat geworden ist und detailliert das Geschehnis schildern muss. Und letztendlich für das Gericht, das ein Urteil fällen muss. Gemäß § 261 StPO entscheidet das Gericht nach seiner freien, aus dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung über das Ergebnis der Beweisaufnahme. Das Gericht muss im Rahmen der Beweiswürdigung also herausfinden, ob es dem Opfer oder dem Angeklagten glaubt. Dabei darf es dem Angeklagten nicht nachteilig ausgelegt werden, wenn er schweigt. Um die Glaubhaftigkeit einer Aussage zu beurteilen, hat der BGH einige Maßstäbe festgelegt. Danach ist unter anderem die Konstanz der Aussage und deren Stimmigkeit, Detailreichtum und Schilderung der Emotionen während der Tat zu prüfen. Auch ein mögliches Falschbelastungsmotiv des Zeugen ist zu berücksichtigen. Besonders tragisch ist es, wenn das Opfer möglicherweise durch ein ähnliches Geschehen aus der Vergangenheit unabsichtlich den Angeklagten belastet, dies aber selbst nicht erkennen kann. Häufig werden aussagepsychologische Gutachten zur Beurteilung der Glaubwürdigkeit des Zeugen in Auftrag gegeben. In diesem Fall wird der Zeuge intensiv durch einen Sachverständigen begutachtet. Hierbei geht es um die Beurteilung, ob auf ein bestimmtes Geschehen bezogene Angaben zutreffen. Dabei ist die vom BGH anerkannte „Nullhypothese“ anzuwenden. Hierbei besteht „das methodische Grundprinzip darin, einen zu überprüfenden Sachverhalt - also die Glaubhaftigkeit der spezifischen Aussage - so lange zu negieren, bis diese Negation mit den gesammelten Fakten nicht mehr vereinbar ist. Der Sachverständige nimmt daher bei der Begutachtung zunächst an, die Aussage sei unwahr. Zur Prüfung dieser Annahme hat er weitere Hypothesen zu bilden. Ergibt seine Prüfstrategie, dass die Unwahrhypothese mit den erhobenen Fakten nicht mehr in Übereinstimmung stehen kann, so wird sie verworfen, und es gilt dann die Alternativhypothese, dass es sich um eine wahre Aussage handelt.“ Im Rahmen der Hauptverhandlung wird der Sachverständige von Gericht, Staatsanwaltschaft, Verteidigung und ggf. Nebenklagevertretung detailliert und kritisch befragt. Das Gericht muss sich dem Gutachten nicht zwangsläufig anschließen. Auch die Verteidigung kann berechtigte Einwände gegen das Gutachten erheben. Zu berücksichtigen ist auch, dass - insbesondere in Sexualdelikten - zwischen Tat und Gerichtsverhandlung oft viele Jahre liegen. Dies ist für alle Beteiligten noch schwerer, da Erinnerungen mit der Zeit bekanntlich immer mehr verblassen. Das Gericht muss nach dem Ende der Beweisaufnahme nicht zu 100 Prozent von der Glaubhaftigkeit eines Zeugen überzeugt sein, um den Angeklagten zu verurteilen. Vielmehr ist nach gefestigter BGH-Rechtsprechung „ein nach der Lebenserfahrung ausreichendes Maß an Sicherheit, demgegenüber vernünftige und nicht bloß auf denktheoretische Möglichkeiten gegründete Zweifel nicht mehr aufkommen,“ ausreichend. Nur, wenn das Gericht nicht überzeugt im Sinne des § 261 StPO ist, kommt der Grundsatz „in dubio pro reo“ - im Zweifel für den Angeklagten zur Anwendung. Die Folge ist dann ein Freispruch. Fazit: In Aussage gegen Aussage Konstellationen ist besonders präzise Arbeit erforderlich. Derjenige, dem das Gericht nicht glaubt, hat mit massiven Folgen zu rechnen. (Frühzeitige) anwaltliche Vertretung ist deswegen besonders wichtig.