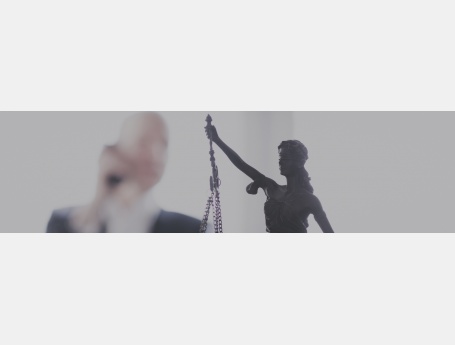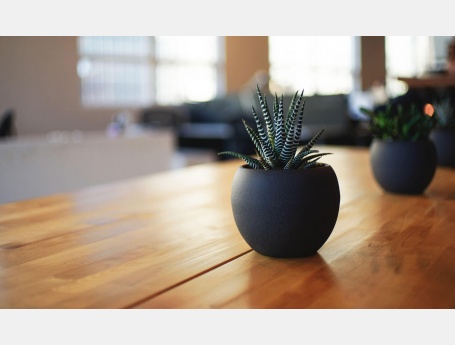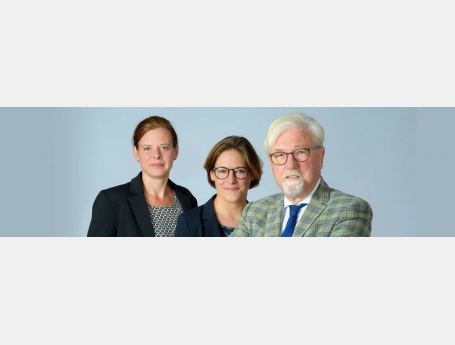Neue Schallschutz-Norm: alter Wein in neuen Schläuchen
Ärger beim Schallschutz im Wohnungsbau lässt sich vermeiden
Der bauliche Schallschutz wird in Deutschland seit 1938 durch die Norm DIN 4109, zunächst DIN 4110, beschrieben. DIN 4109 wurde seit 1944 mehrfach neu gefasst, zuletzt mit der Ausgabe vom Januar 2018. Aber selbst in dieser Ausgabe finden sich teilweise seit 1944 unveränderte Werte für die Schalldämmung von Bauteilen wie Wohnungstrennwänden oder auch -decken. Der bautechnische Fortschritt, der in anderen Bereichen des Bauens zu regelmäßigen Anpassungen der Anforderungen führt, wird normativ nicht beachtet. Dies führt dazu, dass sich Gerichte bis hin zum Bundesgerichtshof regelmäßig mit dem Schallschutz von Wohngebäuden beschäftigen müssen. Der BGH hat zum Schallschutz schon 1998 (Akt.-Z. VII ZR 184/97, 14. Mai 1998) festgestellt, dass DIN Normen die anerkannten Regeln der Technik wiedergeben oder hinter diesen zurückbleiben. Die DIN 4109 kann geradezu als Paradebeispiel einer Norm angesehen werden, die nicht die anerkannten Regeln der Technik beschreibt (BGH Akt.-Z. VII ZR 45/06, 14. Juni 2007). Dennoch haben die beteiligten Kreise beim Deutschen Institut für Normung e.V, dem DIN, 2016 eine neue Fassung mit nahezu unveränderten Werten veröffentlicht. Diese Ausgabe, also DIN 4109-1:2016-07, wurde Anfang 2019 in das niedersächsische Baurecht aufgenommen, obwohl seitens des DIN schon im Juli 2018 eine weitere Fassung (wiederum mit nahezu unveränderten Werten) veröffentlicht wurde. Einige Bundesländer wenden derzeit noch die Ausgabe von 1989 an (Rheinland-Pfalz), andere dann schon die Ausgabe 2018 (Berlin, Hessen …) und der Rest wie Niedersachsen die Ausgabe 2016. Damit dürfte für den durchschnittlichen Planer die Lage als unübersichtlich, für den privaten Bauherrn eigentlich nur noch als chaotisch zu beschreiben sein. Nicht ohne Grund und nach zähen Diskussionen in der Fachwelt trägt die DIN 4109 seit der Ausgabe 2016 inzwischen den Titel „Mindestanforderungen“; im Vorwort der Norm wird angeführt, dass die dort beschriebenen Anforderungen lediglich vor unzumutbaren Belästigungen schützen, was auch immer eine zumutbare Belästigung in der eigenen Wohnung sein kann. Komfort, Ruhe und Geborgenheit benötigen bessere Schalldämmwerte als in DIN 4109, egal welche Ausgabe, angeführt sind. Der heutzutage zu erwartende und geschuldete Schallschutz liegt bei deutlich besseren Werten als durch die baurechtlich eingeführte DIN 4109 festgelegt. Diese Divergenz zwischen baurechtlich notwendigem und zivilrechtlich geschuldeten Schallschutz führt regelmäßig zu Streitigkeiten, enttäuschten Wohnungs- und Hausbewohnern und schlussendlich zu Belastungen und Belästigungen in der häuslichen Umgebung, also unerwünschten Geräuschen, mithin als Lärm bezeichnet. A us Sicht des Akustikplaners lassen sich diese negativen Folgen eines nicht ausreichenden Schallschutzes im Gebäude durch eine frühzeitige Planung und Beratung zum baulichen Schallschutz vermeiden. Dazu können die Vorstellungen und Bedürfnisse der Menschen in einem Gebäude aufgegriffen und durch technische Zielwerte für die Luft- und Trittschalldämmung wie auch Geräusche aus gebäudetechnischen Anlagen beschrieben und idealerweise auch vertraglich vereinbart werden. Erprobte und bewährte Berechnungsverfahren gestatten die Vorausberechnung und damit die exakte Dimensionierung des Schallschutzes im Gebäude. Die dazu notwendigen Konstruktionen für Wände, Decken, Türen, Fenster, Dächer und andere schalltechnisch relevanten Elemente wie Lüftungsanlagen und andere Aggregate lasse sich so eindeutig definieren. Die Richtlinie VDI 4100 „Schallschutz im Wohnungsbau“ beschreibt drei Schallschutzstufen, also unterschiedliche Qualitätsniveaus. Neben den technischen Kennwerten sind dort auch Beschreibungen zur subjektiven Wahrnehmung für die verschiedenen Schallschutzstufen aufgeführt. Es ist ein Unterschied, ob man laute Sprache aus der Nachbarwohnung nur wahrnimmt, oder aber auch den Inhalt versteht. Der Wunsch vieler Bauherren nach Unhörbarkeit von Geräuschen des Nachbarn ist dann häufig mit den finanziellen Vorstellungen abzugleichen. Als Fazit ist festzuhalten, dass der Schallschutz in einem Gebäude durch entsprechende Beratung und Planung nicht zu einem Problem werden muss. Genau wie der Wärmeschutz, die Haustechnik oder die Statik eines Gebäudes ist auch der Schallschutz vorab planbar. Für den baurechtlich erforderlichen Schallschutznachweis ist allerdings nur der Mindestschallschutz nachzuweisen, dessen Schallschutzniveau dann zu Belästigungen und Ärger führt. war nach dem Physik-Studium in Marburg und Oldenburg als Promotionsstipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Stuttgart, tätig. Im Jahr 2000 gründete er das Akustikbüro Oldenburg und wurde im Jahr 2003 von der Oldenburgischen IHK als Sachverständiger für Lärmimmission, Bau- und Raumakustik öffentlich bestellt und vereidigt. Als Berater begleitet er Produktentwicklungen akustisch wirksamer Materialien, führt weltweit Schulungen für Hersteller und Vorträge durch und engagiert sich in der nationalen und internationalen Normung. Im Jahr 2015 gründete er die Schall & Raum Consulting GmbH zur computergestützten Planung der Raumakustik von Büros. Im März 2019 wurde er mit der Rudolf-Martin-Ehrenurkunde des NALS im DIN ausgezeichnet.