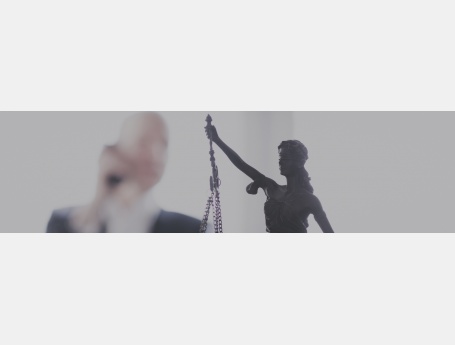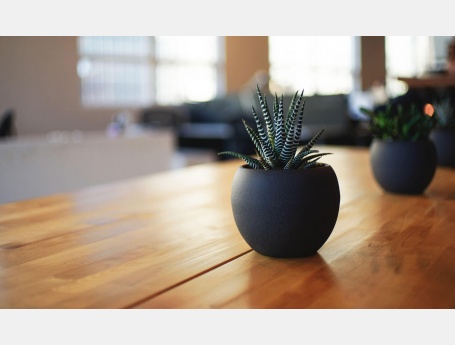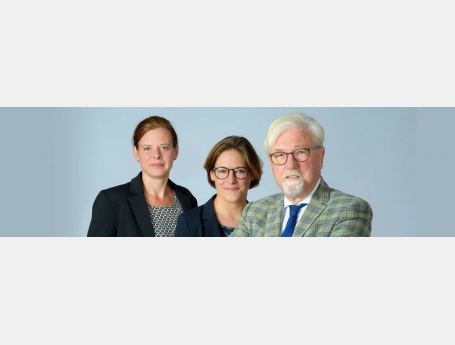Testierfähigkeit in einem lichten Moment
Auch Minderjährige können schon ein Testament einrichten
Abweichend von den allgemeinen gesetzlichen Regelungen zur Geschäftsfähigkeit bestimmt § 2229 Abs. 1 BGB zum Beispiel, dass auch eine minderjährigere Person ein Testament errichten kann, wenn sie das 16. Lebensjahr vollendet hat. Hierbei ist der Minderjährige aber an bestimmte Formvorgaben gebunden. Die mit Vollendung des 16. Lebensjahres beginnende Testierfähigkeit hält grundsätzlich unbeschränkt an. Sie endet jedoch gem. § 2229 Abs. 4 BGB, wenn der Testierende wegen krankhafter Störung der Geistestätigkeit, wegen Geistesschwäche oder wegen Bewusstseinsstörung nicht in der Lage ist, die Bedeutung einer von ihm abgegebenen Willenserklärung einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Dabei geht es aber nicht darum, den Inhalt einer letztwilligen Verfügung auf seine Angemessenheit zu beurteilen, sondern nur darum, ob sie frei von krankheitsbedingten Störungen gefasst werden konnte. Ein in einem solchen Zustand verfasstes Testament ist nichtig; alle darin getroffenen Anordnungen sind ohne Wirkung. Die Erbfolge richtet sich in diesen Fällen nach früheren (wirksamen) Testamenten oder gegebenenfalls nach der gesetzlichen Erbfolge. Eine (möglicherweise) fehlende Testierfähigkeit führt häufig zu Streit zwischen den Erben. Eine Situation, die die Gerichte dabei immer wieder beschäftigt, ist die des sogenannten „lucidum intervallum“ (lat. lichter Augenblick). Mit diesem Begriff wird in der Rechtswissenschaft ein Zeitraum bezeichnet, in dem eine Person trotz einer zugrundeliegenden Bewusstseinsstörung im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte ist. Ein in einem solchen Moment verfasstes Testament ist trotz einer ansonsten bestehenden Erkrankung wirksam. Insofern kann von einer Unterbrechung der Testierunfähigkeit gesprochen werden. Über einen Rechtsstreit zwischen (möglichen) Erben hatte auch das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht (Beschluss vom 15. Mai 2017, Az. 3 Wx 45/16) zu entscheiden: Der gesundheitlich angeschlagene und im Jahr 2015 verstorbene Erblasser hat 4 Kinder hinterlassen. Zugleich gab es zwei Testamente aus den Jahren 2012 und 2014, die teilweise unterschiedlichen Regelungen enthielten. Nach dem Tod des gemeinsamen Vaters stritten zwei der Kinder im Rahmen eines Erbscheinverfahrens darüber, welches der Testamente wirksam und wie der Nachlass zu verteilen ist. In seiner Entscheidung führt das Oberlandesgericht aus, dass grundsätzlich von einer Testierfähigkeit des Erblassers auszugehen ist. Um zu einer Unwirksamkeit des Testaments zu gelangen, muss eine Testierunfähigkeit zur Zeit der Errichtung des Testaments sicher festgestellt werden können. Weil es aber in der Praxis nicht selten so ist, dass sich für den genauen Zeitpunkt der Testamentserrichtung keine psychiatrisch verwertbaren Angaben finden, kommt es nach Auffassung des Oberlandesgerichts durchaus in Betracht, dass der Zustand des Erblassers zum relevanten Zeitpunkt anhand von vor und nach dem Zeitpunkt der Testamentserrichtung dokumentierten Befunden erschlossen wird, wobei sich ein Gericht insbesondere der Hilfe Sachverständiger bedienen kann. Steht fest, dass ein Erblasser zum Beispiel aufgrund einer fortgeschrittenen Demenzerkrankung sowohl vor als auch nach der Testamentserrichtung testierunfähig war, muss davon ausgegangen werden, dass dieser Zustand auch während der Testamentserrichtung vorgelegen hat. Beruft sich eines der Kinder darauf, dass es aber genau im Zeitpunkt der Testamentserrichtung zu einem „lucidum intervallum“, einem lichten Moment, kam, trifft es hierfür vor Gericht die Beweislast. Kann einer solcher ‚lichter Moment‘ des Erblassers nicht bewiesen werden, ist von der (durchgängigen) Testierunfähigkeit auszugehen.