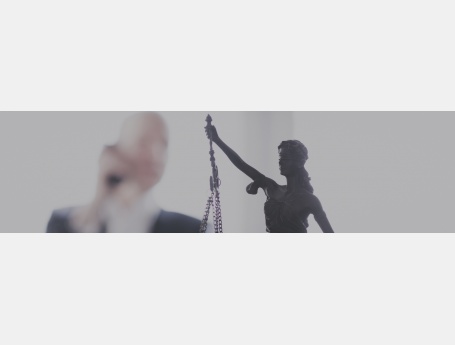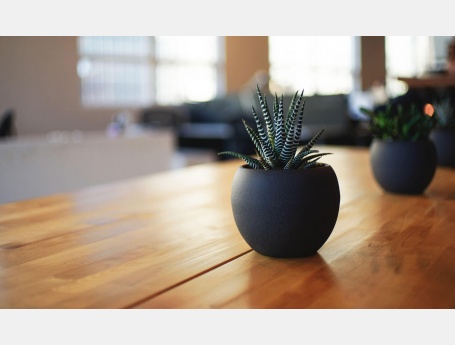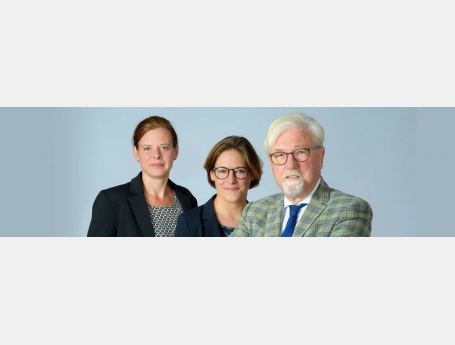Erbvertrag oder Testament
Die Wirksamkeit von handschriftlichen Testamenten
Das privatschriftliche Testament war dabei bereits in der ursprünglichen Fassung des BGB (in Kraft getreten am 01. Januar 1900) enthalten und ist heute auch Ausdruck der verfassungsrechtlich garantierten Testierfreiheit. Trotz der größeren Möglichkeiten sind auch bei einem privatschriftlichen Testament bestimmte formelle Voraussetzungen zu beachten. So ist in § 2247 Abs. 1 BGB festgelegt, dass ein Testament durch eine eigenhändig geschriebene und unterschriebene Erklärung errichtet werden kann. Das Testament muss dabei vom Erblasser selbst vollständig mit der Hand geschrieben sein. Es reicht insbesondere nicht aus, ein ausgedrucktes Testament nur zu unterschreiben. Auch ist es (außer beim gemeinschaftlichen Testament von Ehegatten) nicht möglich, dass eine dritte Person den Text für den Erblasser schreibt und dieser nur seine Unterschrift daruntersetzt. Daneben soll ein Testament Angaben darüber enthalten, zu welcher Zeit (Tag, Monat und Jahr) und an welchem Ort es errichtet wurde. Die Zeit- und Ortsangabe gehört dabei nicht zum notwendigen Testamentsinhalt; gleichwohl empfiehlt es sich, diese Angaben in ein Testament aufzunehmen. So kann z. B. bei mehreren sich inhaltlich widersprechenden Testamenten ermittelt werden, welches der Testamente zeitlich später errichtet wurde und damit den anderen (älteren) Testamenten vorgeht. Ohne Bedeutung für die Wirksamkeit ist dagegen die zeitliche Reihenfolge, in der die einzelnen Bestandteile des Testaments verfasst werden. So kann ein Erblasser ein Testament auch über viele Monate errichten oder zunächst die Unterschrift leisten und später den Text darüber setzen oder einen vorhandenen Text anpassen oder ergänzen, wie auch eine Entscheidung des Brandenburgischen Oberlandesgerichts (Beschluss vom 01. Juni 2021 – 3 W 53/21 –, juris) zeigt: Die Erblasserin, deren Ehemann bereits vorverstorben war, verstarb im Jahr 2018 und hinterließ nur eine Tochter, die wiederum drei Söhne hatte. Die Erblasserin errichtete bereits im Jahr 1998 ein Testament, durch das die Tochter enterbt und stattdessen zunächst ihre zwei namentlich genannten Enkelsöhne als Erben bestimmt wurden. Als dann mehrere Jahre später der dritte Enkelsohn geboren wurde, ergänzte die Erblasserin das Testament handschriftlich an der entsprechenden Stelle um den Namen des dritten Enkelkinds. Nach dem Tod der Erblasserin beanspruchte die enterbte Tochter trotz des Testaments den Nachlass in Höhe von rund 728.000,00 Euro für sich. Sie vertrat die Auffassung, das Testament sei insgesamt unwirksam, weil der Zusatz erst später erfolgte und auch nicht gesondert unterschrieben wurde. Ohne wirksames Testament sei sie deshalb als gesetzliche Erbin erbberechtigt. Zu Unrecht, wie das Oberlandesgericht entschied: Dass die Erblasserin bei der ursprünglichen Abfassung des Testamentes nur ihre zum damaligen Zeitpunkt bereits lebenden zwei Enkelkinder als Erben eingesetzt und den weiteren Enkelsohn erst nach dessen Geburt hinzugefügt hat, ändert an der Wirksamkeit des Testamentes nichts. Es kommt nur darauf an, dass im Zeitpunkt des Todes eine die gesamten Erklärungen nach dem Willen der Erblasserin deckende Unterschrift vorhanden ist. Der Nachlass wurde somit den drei Enkeln zugesprochen.